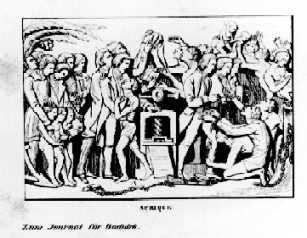
Michael Giesecke
Der Buchdruck in der frühen Neuzeit
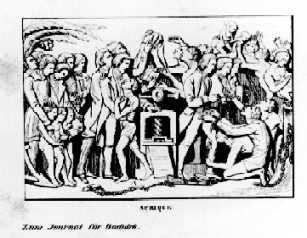
Nachwort zur dritten Auflage
Die Grenzen der Buchkultur und die Chancen der Informationsgesellschaft
Als ich vor acht Jahren dieses Buch abschloß, beschrieben nur einige Spezialisten unsere Kultur als ‘Informationsgesellschaft’. Seit 1994 hat sich dieses Konzept zur Leitidee für das wirtschaftliche, politische und kulturelle Handeln in der europäischen Union und andernorts entwickelt. Es ist von der Idee einzelner Personen und Gruppen zu einer gesellschaftlichen Kraft geworden, die Finanzströme reguliert und die es vermag, über nationale Grenzen hinweg neue Identitäten zu stiften. Die Botschaft der Aktionspläne ‘Europas Weg zur Informationsgesellschaft’ (1994) und ‘Europa als Wegbereiter der globalen Informationsgesellschaft’ (1996) und der zahlreichen anderen Programmschriften lautet im Kern: Wir müssen unser Zusammenleben verstärkt unter dem Gesichtspunkt der gemeinsamen Gewinnung, Speicherung, Verarbeitung und Anwendung von Informationen betrachten und gestalten lernen. Die elektronischen Informations- und Kommunikationstechnologien sind zu einem Katalysator der Veränderung aller Bereiche unseres Zusammenlebens geworden. Sie haben nicht nur die Dynamik des Arbeitsmarktes dramatisch beeinflußt sondern auch unseren kulturellen und ästhetischen Bedürfnissen eine andere Richtung gegeben. Sie können, wie es die politischen Programmschriften ausdrücken, ‘eine zweite Renaissance’ einleiten, wenn es uns denn gelingt, die Chancen, die uns diese Medien für eine alternative Gestaltung unserer sozialen Vernetzung und unserer Beziehung zur Natur - und zu den alten Techniken - eröffnen, zu nutzen.
Dazu müssen wir auch die Möglichkeiten ausschöpfen, die uns die neuen Technologien für alternative Deutungen unserer Umwelt in die Hand geben. Sie sind Erkenntnismedien. Und in dieser Weise nutze ich sie zum Verständnis der Kulturgeschichte. Dieses Buch, wie auch die kurze Zeit später erschienene und in diesem Jahr neu aufgelegte Veröffentlichung ‘Sinnenwandel, Sprachwandel, Kulturwandel’ entwickeln Kategorien für eine informationstheoretische Betrachtung sozialer, technischer, mentaler, sprachlicher und anderer Vorgänge und erproben sie am historischen Material.
Wie die Rezeption des Buches gezeigt hat, haben viele Personen und Gruppen die vorgeschlagenen Perspektiven übernehmen und die gewonnenen Erkenntnisse in den verschiedensten Bereichen nutzen können. Gerade bei jenen, die tagtäglich mit den sozialen Folgen der Einführung der neuen Informationstechnologien konfrontiert werden, haben die beiden Veröffentlichungen breite Aufmerksamkeit gefunden und sind vielfach Anlaß gewesen, das Gespräch mit mir zu suchen. Gewerkschaftler, die sich mit Rationalisierungsfragen befassen; das Kultusministerium, das den Geschichts- und Sachkundeunterricht auf die neuen Medien ausrichten will; Designer, die mehr über die Differenzen zwischen der traditionellen typographischen und der postmodernen Gestaltung wissen wollen; die Kirche, die den Anschluß an die junge Generation und die neuen Medien sucht; Politiker, die Rat für medienpolitische Entscheidungen und für die Perspektiven einer globalen Kulturpolitik brauchen - für sie alle ist ‘Der Buchdruck in der frühen Neuzeit’ nicht bloß Beschäftigung mit Vergangenem, sondern eine aktuelle Orientierungshilfe.

Es zeigte sich in den Diskussionen aber auch, daß die Klärung der Programme einer interaktionsfreien Parallelverarbeitung von Informationen in der Buchdruckära noch keine ausreichenden Perspektiven für die Gestaltung der Informationsgesellschaft liefert. Von der monosensuellen - visuellen - Erkenntnistheorie, den monomedialen Kommunikationstheorien, den auf Sprache und Bewußtsein fixierten Vorstellungen von Informationsverarbeitung, die die typographische Kultur des Industriezeitalters bevorzugt hat, muß sich die Informationsgesellschaft abgrenzen. Sie kann ihre Identität aber nicht nur aus der Negation des Vorhandenen beziehen. Das Informationszeitalter wird wieder mehr von der Komplexität unserer im Prinzip ja multimedialen Kultur zulassen können, als dies in den vergangenen Jahrhunderten möglich war: Kulturen, die auf multimediale Kommunikation fixert waren, haben keine Industrienationen gebildet. Heute sind die Normen und Werte der Buchkultur in vielen Bereichen in Europa und andernorts zu Fesseln geworden, die es verhindern, daß wir die Potentiale der Menschen und auch jene der neuen Medien ausschöpfen können. Was wir benötigen sind multimediale Erkenntnis- und Kommunikationstheorien sowie neue Formen sozialer, auch globaler Arbeitsteilung bei der Informationsgewinnung und -nutzung. Viel mehr Aufmerksamkeit als dies das Zeitalter der Aufklärung für nötig hielt, werden wir auch der Rolle impliziten Wissens, nicht-sprachlicher und kaum bewußtseinsfähiger Information widmen müssen.
Um dies zu erreichen, empfiehlt sich m. E. eine ganz andere, gerade nicht auf den Buchdruck oder eine andere technisierte Form der Informationsverarbeitung ausgerichtete Perspektive. Zukunftsvisionen können wir entwickeln, indem wir uns auf die Verständigung von Angesicht zu Angesicht zwischen mehreren Menschen bei gemeinsamer Kooperation als dem komplexesten Fall multimedialer Kommunikation orientieren. Die paradigmatische Kommunikationssituation des typographischen Zeitalters: Interaktionsfreie Verständigung zwischen Autor und Leser mit Hilfe sprachlicher Texte taugt jedenfalls nicht als Basis für die Entwicklung eines Konzepts multimedialer Informationsverarbeitung und ihrer Verbreitung im Internet. Überhaupt sehe ich in der gegenwärtig in den Sozial- und Medienwissenschaften vorherrschenden Konzentration auf die Untersuchung und Modellierung technischer Medien eine Hauptursache für die Stagnation der Medien- und Kommunikationstheorien. Ich habe mich auch aus diesem Grund schon seit Jahren parallel zu der Auseinandersetzung mit dem Buchdruck mit der Untersuchung von face-to-face Kommunikationen beschäftigt. (Vgl. M. Giesecke/Rappe-Giesecke: Supervision als Medium kommunikativer Sozialforschung. Die Integration von Selbsterfahrung und distanzierter Betrachtung in Beratung und Wissenschaft. Frankfurt 1997.) Daß es, wenn es um die Gestaltung des Zusammenwirkens verschiedener Medien und um eine Verbesserung der Rückkopplungen geht, sinnvoller ist, an nicht-technisierte Kommunikationsformen anzuschließen, habe ich in dem vorliegenden Buch nicht deutlich ausgedrückt.

Feedback auf das Feedback
Mittlerweile liegen mir ca. 40 Besprechungen in Tages- und Fachzeitschriften sowie im Rundfunk vor. Auf die dort und darüber hinaus in Briefen, bei Gesprächen und nunmehr auch im Internet geäußerten Fragen, Einwände und Vorschläge möchte ich auf folgende unterschiedliche Weisen reagieren:
Die Schwierigkeiten der Geisteswissenschaften mit der informationstheoretischen Perspektive
Die in meinen Büchern dargestellten Modelle und Methoden sollen eine eigenständige Perspektive auf alltägliche und wissenschaftliche Analysen kultureller Prozesse ermöglichen. Sie reihen sich damit in gleichartige Bemühungen der Wissenssoziologie, von Kommunikations- und Medienwissenschaftlern, allen voran von M. McLuhan, und von Vertretern anderer Disziplinen ein. Gleichzeitig grenzen sie sich von strukturalistischen und monokausalen Modellvorstellungen und den traditionellen Leitfragen z. B. der Soziologie (Wie ist soziale Ordnung möglich?), der Sprachwissenschaft (Wie läßt sich Sprache als ein Zeichensystem beschreiben?), der Buchwissenschaft (Wie werden Bücher produziert, verbreitet, und wie schließen sie aneinander an?) usf. ab. Wen die Fragen ‘Wie hat die Industriegesellschaft soziale Informationsverarbeitung ermöglicht?’ und ‘Wie lassen sich natürliche, technische, soziale u. a. Vorgänge als kommunikative Rückkopplungsprozesse verstehen?’ nicht interessieren, der kann dieses Buch (nur) als Informationssteinbruch für einen begrenzten Bereich der Kulturgeschichte in den deutschsprachigen Ländern zwischen ca. 1440 und 1550 ausbeuten. Von einem solchen Steinbruch sollte man nicht zuviel Struktur erwarten. Wer keinen Steinbruch sondern ein Kommunikationsmedium sucht, sollte zeitweise die von mir vorgegebenen Standpunkte und Perspektiven übernehmen.
Er braucht dabei seine gewohnten Maßstäbe durchaus nicht aufzugeben. Ich halte die informationstheoretische Betrachtung im Gegensatz zu den Befürchtungen vieler Rezensenten, durchaus nicht für zureichend und schon gar nicht für die einzig mögliche. Als Anhänger des Sowohl-Als auch-Denkens empfinde ich das Nebeneinander verschiedener Konzepte grundsätzlich als eine Bereicherung. Wenn ich also vorschlage, die Geistesgeschichte als Informationsgeschichte zu beschreiben, so meine ich tatsächlich nicht, nur eine solche Beschreibung sei möglich und richtig. Wo immer das Entweder-Oder-Denken angebracht ist, beim Versuch, Kultur zu verstehen, gewiß nicht. Hier dürfte es kaum eine Erscheinung geben, die nur eine einzige Ursache besitzt und deshalb reicht auch eine einzelne Erklärung nicht aus. Aus diesem Grunde nutze ich selbst in dem Buch gelegentlich auch andere Modelle.
Die alternativen Deutungen mancher Zusammenhänge, die vielen Lesern aufgefallen sind und hoffentlich weiter auffallen werden, bestätigen gerade die Überdeterminiertheit sozialer Prozesse. Wenn trotzdem einige Kollegen aus der Sprach- und Buchwissenschaft sowie aus der Mediävistik, die in ihren aspektreichen Werken die Kultur ansonsten keineswegs als eine triviale Maschine behandeln, die informationstheoretische Perspektive als gründlich ungeeignet für kulturelle Prozesse hinstellen und das damit begründen, daß sich von ihrem anderen Standpunkt aus andere Beschreibungen ergeben, als jene, die ich hier präsentiere, dann muß dies (auch) Ursachen haben, die jenseits des wissenschaftlichen Diskurses liegen. Meine Darstellungsweise mag eine sein. Aber im Kern liegen die Verständigungsschwierigkeiten woanders. Es geht darum, ob der Verlust der zentralen Perspektive und der auf sie aufbauenden und sie stützenden Mythen, Werte, Darstellungsweisen, usf. akzeptiert und mit gehöriger Trauer verarbeitet wird, oder ob man sie unkritisch verteidigt und weiterhin zur Richtschnur für die Gestaltung unserer Kultur nehmen will. Die Schrift- und Buchgelehrten, deren Schicksal besonders eng an die typographische Kultur gebunden ist, müssen ihre Rolle in der Informationsgesellschaft neu bestimmen. Die engen Schubladen der Disziplinen scheinen zum Speichern gesellschaftlicher Erkenntnis nicht mehr erforderlich. Ein Deutungsmonopol werden die Fachdisziplinen weder in Bezug auf die Sprache, die Kommunikation, noch auf die Literatur aufrechterhalten können.
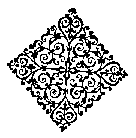
Der Sinn der "Computermetaphorik"
Im Gegensatz zu dem traditionellen Vorgehen, bei der Beschreibung von Informationsverarbeitung zunächst psychische Vorgänge: Sehen, Hören usf., Gedächtnis, Denken, Sprechen, Handeln als Vergleichsmaßstab (Metaphern) heranzuziehen, habe ich mich am technischen Modell elektronischer Datenverarbeitung orientiert.
Dies hatte mehrere Ursachen: Zum einen wollte ich einer Psychologisierung sozialer Prozesse entgegenarbeiten. Die typographische Produktion von Büchern und ihrer Verteilung ist - im Unterschied zum Schreiben - von vornherein und unaufhebbar ein gesellschaftlicher Vorgang, der sich nicht auf die (psychischen) Aktivitäten der beteiligten Personen reduzieren läßt. Zweitens sollte auch die Technik des Buchdrucks als Informationsaustausch und nicht wie herkömmlich als zweckrationaler Werkzeugeinsatz beschrieben werden. Auch hierzu brauchte ich eine allgemeine Terminologie. Drittens sollte die aktuelle Kunstsprache die tatsächliche Ferne, die zwischen mir und der frühen Neuzeit besteht, unmißverständlich deutlich machen. Viele Worte sind über die Jahrhunderte in ihrer graphischen Gestalt gleich geblieben und dies verführt auch ausgebildete Historiker immer wieder zu der Annahme, daß die Bedeutung, die wir diesen Zeichen heute zuschreiben, dieselbe sei, wie jene, die die Menschen vor 600 Jahren zuschrieben. Das ‘Lesen’ beschreibt im 15. Jahrhundert aber andere Prozesse als das ‘Lesen’ 1990. Wir vergleichen deshalb Äpfel mit Birnen, wenn wir beispielsweise die Alphabetisierungsraten in der frühen Neuzeit mit jener heute vergleichen. Meine Verwendung der Computersprache dürfte hinreichend klar machen, daß und wie ich projiziere. Da die meisten Einwände gegen meine ‘moderne Terminologie’ von der m. E. unwahrscheinlichen Annahme ausgehen, unsere Alltagssprache oder deren Verkleidung mit quellensprachlichen Ausdrücken sei weniger ‘anachronistisch’, d. h. eher im Einklang mit der damaligen Wahrnehmung und dem historischen Sprachgebrauch, fühle ich mich in meinem ‘verfremdenden’ Vorgehen bestärkt. Auch den Vorwurf, dies sei nicht neu, sondern entspreche einer dramaturgischen Idee von B. Brecht, nähme ich gerne in Kauf.
Viertens wollte ich durch die Verwendung der Sprache der Computerkultur einen Vergleich zwischen den aktuellen Innovationsprozessen und jenen in der frühen Neuzeit erleichtern. Dieses Buch und der Band ‘Sinnenwandel, Sprachwandel, Kulturwandel’ sind als ‘Studien zur Vorgeschichte der Informationsgesellschaft’ angelegt. Sie beschreiben, was mir aufgefallen ist, als ich innovative kulturelle Prozesse im 15. und 16. Jahrhundert als soziale, durch technische Medien verstärkte Informationsverarbeitung betrachtet habe. Sie wollen einen Beitrag zu einem besseren Verständnis der technischen und sozialen Voraussetzungen derjenigen Formen von Wissensproduktion leisten, die wir im Augenblick auf sehr vielen Feldern gründlich umbauen. Man wird den aktuellen Wertewandel in unserer Gesellschaft und die Perspektiven der Entwicklung der elektronischen Medien und Netze nicht verstehen, wenn man nur die vergangenen 20 Jahre ins Auge faßt und bloß die postmodernen Werte und Medien selbst einer Analyse unterzieht. Dies ist, als wolle man aus den Herztönen des Ungeborenen im Bauch einer Schwangeren auf dessen berufliche Zukunft schließen. Eine Kritik der Fernsehkultur und sozialwissenschaftliche Analysen der Einführung von Computern sind notwendig, aber sie zielen zu kurz.
Wirklich tiefgreifender sozialer Wandel läßt sich nur aus einer Makroperspektive begreifen. Wenn tatsächlich an der Wende zum dritten Jahrtausend epochale Veränderungen anstehen, dann dürfte selbst ein Rückblick auf die letzten 100 Jahre und die Einführung der elektronischen Medien nicht ausreichen. So wie die Renaissance bis in die Antike zurückblickte, um sich ihrer neuen Identität bewußt zu werden, so wird auch die Informationsgesellschaft ihr eigenes Profil nur im Vergleich zur Industriegesellschaft, wie sie sich seit der frühen Neuzeit entwickelt hat, gewinnen.
Daß wir uns erst seit wenigen Jahren als ‘kognitive’ oder ‘wissensbasierte’ Gesellschaft beschreiben, bedeutet keineswegs, daß unser Alltag vorher nicht auch schon durch Prozesse der Informationsgewinnung und -verarbeitung und durch Kommunikation geprägt gewesen ist. Die elektronischen Medien haben es uns lediglich erleichtert, das zu erkennen, was wir - als Individuum, als Gruppe und als Gesellschaft - immer schon gewesen sind: informationsverarbeitende Systeme. Ich sehe aus diesem Grunde auch keinen Anachronismus darin, die frühe Neuzeit als ein Informationssystem zu beschreiben.
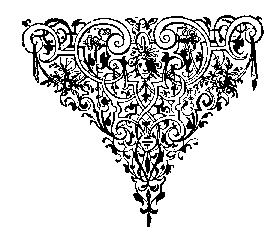
Gibt es ein Metamodell der Informationsverarbeitung?
Die Aufforderung, die alten Medien in der Sprache der neuen Medien zu beschreiben, hat noch aus anderen Gründen zu Mißverständnissen geführt. Georg Jäger sieht in ihrer Befolgung in der wohl gründlichsten Auseinandersetzung mit meinen theoretischen Grundannahmen eine ‘unzulässige Einnahme eines Metastandpunktes’. (‘Die theoretische Grundlegung in Gieseckes ‘Der Buchdruck in der frühen Neuzeit’’ in: Intern. Archiv f. Sozialgesch. d. dt. Lit., Bd. 18, H. 1, 1993: 179-196, hier 191). Unzulässig, weil damit im Gegensatz zu meinem erklärten Ziel eines multiperspektivische Herangehens eine Prämierung der elektronischen Kommunikationssysteme vorgenommen wird, die im übrigen ganz der Mystifizierung der typographischen Informationsverarbeitung im Industriezeitalter entspricht. Unzulässig auch, weil ‘die Subsumtion unterschiedlicher Sachverhalte unter wenige, nicht weiter differenzierte Begriffe aus dem Wörterbuch der Datenverarbeitung zu einer Entdifferenzierung und Metaphorisierung führt’. (188) In der Tat steht hinter allem meine Voraussetzung einer ‘strukturellen Homologie organischer, neuronaler und technischer Prozesse’. (189) Diese Prozesse lassen sich m. E. genau dann als funktional und strukturell ähnlich beschreiben, wenn sie als Informationsverarbeitungs- und/oder Spiegelungsvorgänge begriffen werden! Weil sie unter dieser Perspektive gleich sind, fallen
Die Suche nach einem sinnvollen Spezifitätsniveau für die informationstheoretischen Grundbegriffe bleibt eine gemeinsame Aufgabe. Der Informationsbegriff der Computerkultur ist natürlich ein historischer Spezialfall, ähnlich dem typographischen Wissensbegriff, der den Anforderungen einer zukünftigen multimedialen Kultur ohnedies nicht gewachsen ist. Offenbar habe ich in diesem Buch die Computerterminologie für viele Leser zu extensiv genutzt. Nicht jeder kann sich an den Verfremdungseffekten erfreuen. Die Übertreibung macht aber das Prinzip nicht hinfällig: Um die Wahl eines Bezugssystems - psychische, soziale, biogene, technische usw. Informationssysteme - kommen wir nicht umhin. Einen Standpunkt jenseits des Kosmos können wir nicht einnehmen.
Als Ausweg bleibt m. E. nur, in einem geordneten Wechsel verschiedene Kommunikations- und Informationsmodelle als Vergleichsmaßstab anzulegen. In diesem Buch verwende ich vorzugsweise das physikalische Spiegelungsmodell und die technischen Informationssysteme. In den Kapiteln 6 - 9 des Buches ‘Sinnenwandel, Sprachwandel, Kulturwandel’ nutze ich das menschliche psychische System und in den letzten Kapiteln der Arbeit ‘Von den Mythen der Buchkultur zu den Visionen der Informationsgesellschaft’ nehme ich das Gruppengespräch als Paradigma sozialer und technischer Informationsverarbeitung und Vernetzung. Jeder Ansatz hat seine Vor- und Nachteile - und er zieht typischerweise verschiedene Lesergruppen an.
Handschrift und Druck: Wechsel des Emergenzniveaus menschlicher Informationsverarbeitung
Einen weiteren häufigen Diskussionspunkt bot das Verhältnis zwischen mittelalterlichen und neuzeitlichen Informationstechniken. Ich sehe in der typographischen Buchproduktion den Beginn und das Vorbild aller weiteren industriellen Warenproduktion. Die typographische Wissensproduktion ist, wie die übrige neuzeitliche Produktion auch, auf den Markt als Vernetzungsmechanismus angewiesen und kann (auch) deshalb nur als ein gesellschaftlicher Prozeß erfaßt werden. Die Normierung der Wahrnehmung, des Denkens und Beschreibens, der Sprache sowie die Professionalisierung der Nutzung von Buchinformationen usf. sind Beiträge zur Lösung des Problems interaktionsfreier Massenkommunikation. Das typographische Kommunikationssystem der industrialisierten Nationalstaaten ist durch unabzählbar viele Teilnehmer und Vernetzungsmöglichkeiten gekennzeichnet, die Autoren und Medien müssen sich auf ein disperses Publikum einstellen. Man mag die Manuskriptproduktion verstehen, indem man sich Werkstätten, Auditorien, Tradierungsketten und damit sehr kleine soziale Gruppen anschaut. Das Schreiben und die Schrift sind Leistungen psychischer Systeme - die typographische Fabrikation von Erkenntnis kann man weder mit Bezug auf das einzelne Individuum noch auf überschaubare Menschengruppen erklären. Die Register, die Abbildungen und die Paginierung, das neue Layout usf. vieler hochmittelalterlicher Handschriften, sollten weder eine gesellschaftliche Informationsverarbeitung ermöglichen - noch hatten sie defacto ein solches Ergebnis. Sie waren psychologisch, bestenfalls gruppenpsychologisch motiviert.
Wer also den Unterschied zwischen individueller Informationsverarbeitung und bestenfalls noch der einfachen Addition ihrer Produkte einerseits und der arbeitsteiligen gesellschaftlichen Informationsproduktion andererseits nicht kennt, der wird meine Unterscheidung zwischen Handschrift und Druck nicht verstehen - und er wird auch Schwierigkeiten haben, die neuen Strukturen der Informationsgesellschaft zu erkennen. Die skriptographischen Medien erweitern die Ressourcen der psychischen Informationsverarbeitung des einzelnen Menschen, der Druck ermöglicht die Parallelverarbeitung von Informationen im nationalen Maßstab und die Neuen Medien werden globale Kommunikationssysteme schaffen.
An diesen Chancen sind die Informationstechnologien zu messen - nicht an ihrer empirisch natürlich in vielen Fällen nachweisbaren restriktiven Nutzung.
Solange diese grundlegenden Unterschiede nicht ausreichend gewürdigt werden, sehe ich kaum Sinn in der Suche nach einer Kontinuität zwischen Handschrift und Buchdruck, die mir von vielen Seiten empfohlen wurde. Sind die Systemreferenzen deutlich, so stellt sich die Frage des Übergangs anders - aber sie sollte natürlich auch beantwortet werden. Dies geschieht in diesem Buch an vielen empirischen Beispielen. So zeige ich, wie traditionelle Ziele - Gutenbergs Idee ein harmonisches, schönes Buch zu verfertigen, perspektivisch korrekte Zeichnungen zu erstellen, dem städtischen Nutz mit Büchern zu dienen usf. - dadurch, daß sie mit neuen Medien verfolgt werden, einen anderen Sinn erhalten und auch ganz andere Effekte zeitigen. In dem nun abgeschlossenen Manuskript (Von den Mythen der Buchkultur zu den Visionen der Informationsgesellschaft) systematisiere ich solche Beobachtungen nach dem Muster des gruppendynamischen Entwicklungsmodells ‘Abhängigkeit, Gegenabhängigkeit, Autonomie’ und wende sie auf die aktuelle Medienrevolution an. Es wäre in der Tat lohnend, auch den frühneuzeitlichen Umbruch noch einmal nach einem solchen sozialpsychologischen - oder einem anderen - Transformationsmodell zu beschreiben.
Ebenso sehr würde ich es begrüßen und unterstützen, wenn jemand Jan Dirk Müllers Vorschlag die ‘Auswirkungen des Drucks in traditionell den Geisteswissenschaften zugerechneten Disziplinen’ genauer zu verfolgen, aufgriffe (Internat. Archiv f. Sozialgesch. d. dt. Lit., Bd. 18, H. 1, 1993: 168-178). Neben vielen Korrekturhinweisen, die ich dankbar genutzt habe, gab er mir auch den Rat, den Abschnitt über ‘Die Technisierung der Unterhaltungskunst’ (298ff) neu zu gestalten. (Ebd. S. 176) Dies sind Themen, die nochmals ein großes Quellenstudium erfordern und sicherlich in einem voluminösen Buch enden werden.
Zuletzt möchte ich dem Leser noch eine Warnung von Michael Schmolke aus seiner Besprechung in ‘Communicatio socialis’ weiterreichen: Er ‘muß ambivalent belastbar sein’! (H. 3, 1994: 312-314, hier 314) Daß die Welt multidimensional, polyzentrisch und ohne Hierarchie vernetzt ist und daß deshalb viele Standpunkte und Perspektiven zu ihrer Beschreibung erforderlich sind, für die es keine natürliche Rangfolge gibt, gehört mittlerweile zum Credo postmodernen Denkens. In die kommunikative Welt mit ihren Spiegelungsprozessen sollte man überhaupt nur einsteigen, wenn man Freude an Ambivalenzen, Paradoxien und individueller und sozialer Selbstreflexion hat. Es ist kein Zufall, daß ‘Kommunikation’ und vor allem das Reden über Kommuniktion erst von dem Augenblick an seinen gewaltigen Bedeutungszuwachs erfahren hat, in dem sich unser ganzes Denken und Wirtschaften von linearen, logischen und monokausalen Idealen wegbewegt. Ein Konzept von Kommunikation ist nur in Theorien und Weltbildern erforderlich, die von der Unaufhebbarkeit verschiedener Standpunkte und Perspektiven ausgehen - und die deren Gleichartigkeit in jeder Kommunikation doch immer wieder voraussetzen. Jeder Hörer wird nur zum Hörer, weil er zugleich auch Sprecher ist, schweigt und doch bedeutet, daß er zuhört und zur Erwiderung bereit ist. Jeder Sensor und jeder Effektor ist sowohl das eine als auch das andere. Wer das eine ohne das andere haben will, sollte auf die traditionellen (linearen) Handlungs- oder Wahrnehmungstheorien zurückgreifen. Aber genau vor dieser Komplexität ist auch die Buchkultur zurückgeschreckt. Sie hat das Kommunikationsproblem tayloristisch vereinfacht, die Rückkopplung verlangsamt und gedehnt. Die Informationsgesellschaft wird ihr eigenes, den neuen Medien angemessenes Kommunikationsideal entwickeln müssen. Sie scheint dabei gerade erst im Begriff die Phase der ‘Abhängigkeit’ zu verlassen.

Bordenau, im Januar 1998