| Gespräch und Gedächtnis in der Medienwelt | |
| Krise und Wandel der kulturellen Kommunikation |
| (Vortrag in der Ringvorlesung des Studiums Generale an der Universität Bern am 13.5 1999. Erschienen in: P. Rusterholz, R. Moser, Die Zukunft der Natur- und Kulturwissenschaften, Berner Universitätsschriften, Bern/Stuttgart/Wien) |
| Inhalt |
| 1. |
Einleitung |
| 2. | Kommunikation als Kreislauf der Informationsverarbeitung |
| 3. | Kulturen als multimediale Ökosysteme |
| 4. | Natur- und Kulturwissenschaften? |
| 5. | Die Ambivalenz der Informationsverarbeitung und der sie modelierenden Kategorien |
| 6. | Konzepte kultureller Veränderung |
| 7. | Welche Konsequenzen ergeben sich hieraus für die Erforschung kultureller Kommunikation |
| 8. | Anmerkungen |
| |
|
| 1. Einleitung |
|||||||||||||
| Als Herr Moser bei mir anfragte, ob ich einen
Vortrag zum Thema 'Vergessen und Erinnern in der Medienwelt: Krise oder
Wandlung des kulturellen Gedächtnisses?' hier im Rahmen des Collegium
Generale in Bern halten wolle, habe ich gezögert. Wie Sie der Ankündigung
entnehmen konnten, lautet der Titel nun abweichend: Gespräch und Gedächtnis
in der Medienwelt: Krise und Wandel der kulturellen Kommunikation. Zwei Akzente sind jetzt anders gesetzt: Das Gespräch tritt vor und neben das Gedächtnis und die Alternative 'Krise oder Wandlung' ist als 'Sowohl-Als-Auch' formuliert. Ich werde in der folgenden Stunde versuchen zu erläutern, warum es für einen Kommunikations- und Medienwissenschaftler schwierig ist, isoliert über das Gedächtnis zu sprechen und warum für ihn Zerstörung und Krisen zum beruhigenden Normalfall der Evolution kultureller Kommunikation gehören. |
|||||||||||||
| 2. Kommunikation als Kreislauf der Informationsverarbeitung |
|||||||||||||
| Zunächst also zum ersten Punkt. Warum habe ich mich gegen eine Fokussierung auf das Gedächtnis ausgesprochen? Ich stelle mich ja damit gegen eine Form der Arbeitsteilung, die für die neuzeitliche Wissenschaft typisch ist. Wir sind es gewohnt, daß manche Disziplinen sich mit der Wahrnehmung, andere mit dem Denken, andere mit Speichertechniken, wiederum andere mit dem Handeln und der Anwendung des Wissens befassen. Wie die Arbeitsteilung auf anderen Feldern, hat uns auch diese viele Vorteile und einen mächtigen Erkenntnisfortschritt gebracht. Aber sie hat auch erhebliche Nachteile und ich vermute mal, daß es in den Wissenschaften ebenso wie in der Wirtschaft Zeit ist, flachere Hierarchien einzuziehen und neue Untersuchungs- bzw. Wirtschaftseinheiten zu konstruieren. Den Aufstieg der Begriffe Kommunikation, | (Seite 69) | ||||||||||||
| Information und Multimedialität zu Generalmetaphern
deute ich als Ausdruck eines solchen Bedürfnisses zu neuen Untersuchungszellen.
Die Suche nach einer Untersuchungszelle, die für die Kommunikationswissenschaft
eine vergleichbare Funktion wie die Atome für die Physik, die chemischen
Elemente für die Chemie, die Zelle für die Biologie einnehmen
kann, hat meine Arbeit lange geprägt. Ein Ergebnis ist das Modell von
Kommunikation als einem Informationsverarbeitungskreislauf. |
|||||||||||||
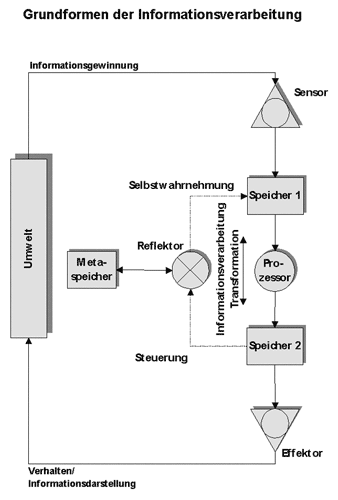 |
|||||||||||||
| Abbildung1: Grundformen der Informationsverarbeitung |
|||||||||||||
| (Auf die beiden anderen Konzepte, mit denen ich arbeite: Kommunikation als Spiegelung und Kommunikation als Vernetzung von Kommunikatoren kann ich | (Seite 70) | ||||||||||||
| in diesem Vortrag nicht eingehen. Es ist mir
aber wichtig, darauf hinzuweisen, daß selbst, wenn man sehr allgemeine
Kommunikationskonzepte zugrunde legt, ein einzelnes Modell nicht ausreicht.) Wenn man dieses Modell einmal auf die psychische und soziale Informationsverarbeitung anwendet, dann wird klar, daß Wahrnehmung, Speicherung, Verarbeitung und Darstellung von Informationen nur Phasen in einem zirkulären Prozeß sind, die für sich allein nicht beschrieben werden können. Oder anders ausgedrückt: Wenn wir diesen Kreislauf nur als eine Addition von Wahrnehmung, Gedächtnisleistung, kognitiven Verarbeitungsprozessen, Handlungen usf. verstehen wollen, dann brauchen wir keine Kommunikationswissenschaft und keine kulturelle Informatik. Wir sollten weiterhin psychologische und soziale Erkenntnis-, Gedächtnis, Handlungs- und andere Theorien entwickeln und in eigenen Disziplinen auf deren Grundlagen forschen. Die Ergebnisse kann sich der Leser bei Bedarf zusammenstellen. Oder diese Aufgabe wird schon von Herausgebern übernommen, die Sammelbände über interdisziplinäre Projekte als Addition traditioneller einzelwissenschaftlicher Disziplinen edieren. Erst wenn unser Interesse darauf abzielt, das eigentümliche Niveau zu erkunden, auf dem aus dem Zusammenspiel der verschiedenen physikalischen, chemischen, biogenen, psychischen, sozialen und anderen Prozesse und Elemente menschliche und kulturelle Informationsverarbeitung emergiert, kommen wir um eine neue kulturelle Informatik und Medienwissenschaft nicht mehr herum. Diese geht in der Tat transdisziplinär vor, indem sie auf den Ergebnissen der Einzelwissenschaften aufruht und eine Perspektive zu deren Verknüpfung bietet. Man kann auch einen anderen Vergleich heranziehen: Als die Kwler kamen war die Welt schon unter den Disziplinen aufgeteilt. Ein Blick auf die Abb. 1 zeigt, daß sich die Wahrnehmung von Mensch und Tieren, Industrienationen usf. nicht verstehen läßt, wenn man nicht die jeweils zentralen Speichermedien und die jeweils anschließenden Verarbeitungs- und Kommunikationsformen berücksichtigt. Und zwar hängen diese Prozesse nicht linear miteinander zusammen, sondern die permanenten Steuerungs- und Regelungsleistungen geben der Informationsverarbeitung einen grundsätzlich zirkulären Charakter. Sie führen z. B. dazu, daß auch Verarbeitungsleistungen auf die sensorischen Aktivitäten zurückwirken. Deshalb macht es aus kommunikationswissenschaftlicher Sicht keinen Sinn, sich mit dem Gedächtnis ohne mit dem Gespräch, sich mit dem Sehen ohne mit den historisch oder biographisch relevanten Speichermedien zu befassen. Es gibt - funktional zu den Informationskreisläufen in die Wahrnehmung, Gedächtnis, Sprechen usf. jeweils |
(Seite 71) | ||||||||||||
| in der Kulturgeschichte
oder in der Ontogenese des Menschen eingebettet sind - ganz unterschiedliche
Formen der Informationsgewinnung und -speicherung. Mit dieser Überzeugung
habe ich mein Buch über den Buchdruck in der frühen Neuzeit geschrieben.
Ich zitiere dort ganz am Anfang Galilei '"Man glaube nicht", so
schreibt er in seinen Betrachtungen zur Leistung des Kopernikus, "daß
es um die tiefen Begriffe zu fassen, die in jenen Karten des Himmels geschrieben
stehen, genügt, den Glanz der Sonne und der Sterne in sich aufzunehmen
und ihren Auf- und Niedergang zu betrachten: denn dies alles liegt auch
vor den Augen der Tiere und vor denen des ungebildeten Haufens offen zutage."
Nicht nur den Schriftgelehrten also auch den ungebildeten Menschen und sogar
den Tieren offenbart sich die Welt durch die Augen. Für 'künstliche'
wissenschaftliche Erkenntnisse ist mehr erforderlich als das, "was
der bloße Sinn des Sehens uns gibt". Dieses 'Surplus' heißt
bei Galilei experimentelle Methode, Verstand und - in diesem speziellen
Fall - Fernrohr. Gefragt ist im Zeitalter der typographischen Kultur perspektivisches,
einäugiges Sehen, erforderlich sind materielle Werkzeuge wie der Visierstab,
Albertis Vetro tralucente (Glasscheibe), das Fernrohr und recht bald auch
das Mikroskop. Erst diese Mittel und die soziale Normierung des Erkenntnisvorganges
ermöglichen intersubjektive Überprüfungen und alle jene weiteren
Merkmale, die in der Gegenwart von 'wahren' Informationen gefordert werden."
(Frankfurt a. M. 1998, S. 35) Das Sehen des Galilei und die in der wissenschaftlichen Fachliteratur gespeicherten Informationen sind Ausschnitte aus einem voraussetzungsvollen Informationskreislauf, eben der (typographischen) Buchkultur. Das Sehen als anthropologische Konstante ist demgegenüber kein Gegenstand einer kulturellen Informatik - ebenso wenig übrigens das Schreiben und Lesen. Die Abb. 2 macht mit den wichtigsten Stationen dieses rekursiven Ablaufs vertraut. Die Leser meiner Bücher werden das Schema kennen. |
(Seite 72) | ||||||||||||
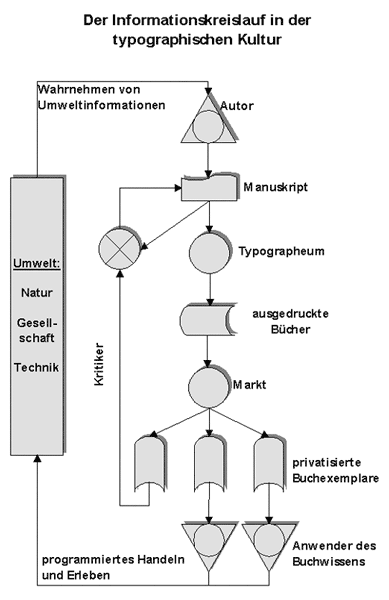 |
|||||||||||||
| Abbildung 2: Der Informationskreislauf in der typografischen Kultur |
|||||||||||||
| Zur Illustration
der Abhängigkeit der verschiedenen Phasen bitte ich Sie für einen
Augenblick einer Aufführung eines klassischen Tanzes auf Java oder
Bali beizuwohnen. Irgendwann wird ein Tänzer die folgende, schon seit
dem 8. Jh Jahr- |
(Seite 73) | ||||||||||||
| hunderte bekannte
und z. B. auf Friesen des Borobodu- und Prambarantempels dargestellte Haltung
einnehmen. (1) |
|||||||||||||
 |
|||||||||||||
| Abbildung 3: Ausschnitt aus einem Basrelief des Prambaran- Tempels (nordwestlich von Yogjakarta), 8./9. Jahrhundert |
(Seite 74) | ||||||||||||
| Wir können
die tänzerische Grundstellung und ihre Veränderung mit einem durch
die neuzeitliche Wissenschaft geprägten visuellen Sinn erkennen und
z. B. als Zeichnung dokumentieren. Das könnte dann folgendermaßen
aussehen: |
|||||||||||||
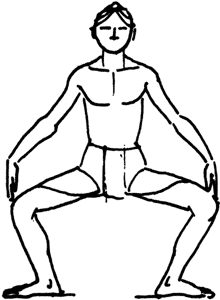 |
|||||||||||||
Abbildung 4: Grundstellung des klassischen javanischen Tanzes (nach P.A.Suriyadiningrat) (2) |
(Seite 75) | ||||||||||||
| Natürlich werden auch die Indonesier neben uns dem Tanz zuschauen. Wenn sie jedoch eine Grundschule in Yogjakarta in Ubud oder andernorts besucht haben, dann kennen sie die Figur aus eigener Übung. Der Anblick kann mit ihren kinästhetischem Gedächtnis gekoppelt werden. Dann wird er zum Aufbau eines spezifischen Spannungszustandes in den Beinmuskeln führen. Beim Nachempfinden der in Abb.4 skizzierten Grundstellung wird die Spannung geringer sein als beim Hineinversetzen in die Rhomben- Position, die die Abb.3 wiedergibt. Beim Anblick der Bewegung des Tänzers werden sensomotorische Erlebnisqualitäten freigesetzt, die wiederum mit psychischen und akustischen Reizen verknüpft sind. Das Tanzen wird weniger als figuraler Ablauf in der Umwelt des Zuschauers als vielmehr als Affekt im eigenen Körper erlebt. Entsprechend kann die Selbstwahrnehmung des eigenen Körpers zur Grundlage des Fremdverstehens genommen werden. Das Medium Tanz führt zu grundsätzlich anderen Prozessen der Informationsverarbeitung in den beiden Kulturen. Diese Unterschiede werden u.a. dadurch verwischt, daß wir für beide Rezeptionsvorgänge den gleichen Ausdruck 'Zuschauen' verwenden. |
|||||||||||||
3. Kulturen als multimediale Ökosysteme |
|||||||||||||
| Ich will auf
den zirkulären Charakter kommunikativer Informationsverarbeitung
nicht länger eingehen und werde die Aufmerksamkeit stattdessen auf
einen zweiten Aspekt lenken, den ich vielleicht in älteren Arbeiten
nicht klar genug herausgestrichen habe. Es ist ganz üblich, die Buch- und Industriekultur als soziales System zu betrachten und wir können aus kommunikationswissenschaftlicher Perspektive im Anschluß daran auch Aussagen über die Spezifik sozialer Informationsverarbeitung machen. Ebenso können wir die Psychodynamik von Schreiben, Lesen, Bücher Kaufen usf. untersuchen. Wir rekonstruieren dann Formen psychischer Informationsverarbeitung. Bei diesen und vielen weiteren Ansätzen, die die Phänomene als Netzwerke von Elementen gleicher Art behandeln, sehe ich keine Notwendigkeit von Kulturanalysen zu sprechen. Ich glaube auch nicht, daß die entstehenden Modelle in dem Sinne als Ökosystem betrachtet werden können, wie dieser Ausdruck in den Natur- und Ingenieurwissenschaften verwendet wird. Wenn die Kulturwissenschaften eine eigene Berechtigung für sich beanspruchen wollen, dann müssen |
(Seite 76) | ||||||||||||
| sie einen Unterschied zwischen kulturellen und anderen, vor allem sozialen Phänomenen sowie zwischen Systemen und Ökosystemen machen. Dieser Unterschied wird m. E. nicht zufälligerweise durch eine weitere von mir schon erwähnte Generalmetapher unserer Zeit thematisiert: Multimedialität. Wenn wir beliebige Phänomene als Kultur betrachten, dann sind wir am Zusammenwirken unterschiedlicher Emergenzformen der Materie: sozialer, psychischer, physikalischer, biogener usf. interessiert. Wenn Biologen oder Agrarwissenschaftler Ökosysteme untersuchen, dann wollen sie wissen, wie verschiedene Arten von Pflanzen und Tiere miteinander, mit dem Klima, dem Boden und anderen Medien interagieren. Wer nur Phänomene auf einem Emergenzniveau untersucht, sollte seine Beschäftigung nicht ökologisch oder kulturwissenschaftlich nennen. Wer als Kommunikationswissenschaftler Kulturen beschreiben will, braucht eine Ontologie der Informations- und Medientypen. Die typographische Kultur kann nur als ein multimediales Gebilde verstanden werden, als ein komplexes Ökosystem, das aus psychischen, sozialen, biogenen u. a. Subsystemen bzw. Medien aufgebaut ist. Die nachfolgende Abbildung (5) mag das Zusammenwirken der verschiedenen Medien und damit Informationstypen in der Buchkultur noch einmal veranschaulichen. Informationsverarbeitung und Kommunikation in multimedialen Systemen meint immer auch Transformation zwischen Medien und/oder Seinsformen der Materie, Metamorphose. (3) | (Seite 77) | ||||||||||||
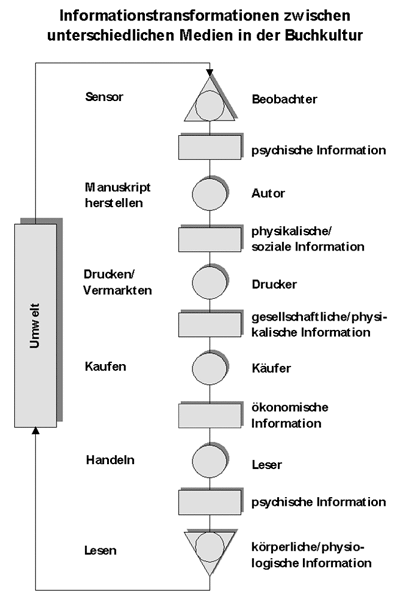 Abb. 5: Informationstransformationen zwischen unterschiedlichen Medien in der Buchkultur |
(Seite 78) | ||||||||||||
4. Natur- und Kulturwissenschaften? |
|||||||||||||
| Gestatten Sie
mir an dieser Stelle eine Anmerkung zum Thema der Vortragsreihe des Collegium
Generale hier in Bern im SS 1999. Es lautet 'Die Zukunft der Natur- und
Kulturwissenschaften'. Eine Konsequenz des von mir vorgeschlagenen Projekts
der Kulturwissenschaft ist, daß die Natur- und Ingenieurwissenschaften
ebenso wie die Geistes- und Sozialwissenschaften integraler Bestandteil
dieses Projekts sind. Es gibt keinerlei Hierarchien zwischen den beteiligten
Disziplinen, schon gar nicht eine Leitfunktion der Sozialwissenschaften.
Man kann bei der Untersuchung von Ökosystemen seine Aufmerksamkeit
auf das eine oder das andere Subsystem lenken aber es macht keinen Sinn
zu sagen, der eine oder andere Faktor sei wichtiger als der andere. Und
entsprechend ist auch jede Disziplin Spezialist für einen oder mehrere
Teilbereiche und muß sich um Kompetenz in anderen bemühen.
Solange wir jedenfalls noch einen Kulturbegriff verinnerlicht haben, der
die Natur- und Ingenieurwissenschaften nicht einschließt, oder diese
gar als Gegenpart zu den Geisteswissenschaften behandelt, sind wir für
die Zukunft nicht gerüstet. Ich will nicht verschweigen, daß ich eine solche Position vor sechs Jahren nicht mit gleicher Überzeugung vertreten habe. Aber die enge Zusammenarbeit mit den Kollegen und Studierenden an meinem seitherigen Arbeitsplatz, im Fachbereich Gartenbau, in den letzten Jahren hat mir gezeigt, daß von dieser Seite die Bereitschaft und die Notwendigkeit zu transdisziplinärem Herangehen und zur Berücksichtigung von Erkenntnissen anderer Disziplinen nicht geringer ist, um es vorsichtig auszudrücken, als in den Sprachwissenschaften oder der Psychologie, also den Bereichen, in denen ich in der Zeit davor gearbeitet habe. Mehr noch: Gerade was die Erforschung von Phänomenen unter dem Gesichtspunkt der Informationsverarbeitung, oder in der Sprache der Biochemiker: der Signaltransduktion angeht, gibt es in diesen Wissenschaften große Anstrengungen und vorzügliche Ergebnisse. Ich denke, daß die einseitige Orientierung an geistes- und sozialwissenschaftlichen Modellen der Informationsverarbeitung und Kommunikation für eine Kommunikationswissenschaft, die sich multimedialen und kulturellen Gegenständen zuwendet, unvorteilhaft ist. Für meine Überlegungen sind jedenfalls wesentliche Impulse eher von naturwissenschaftlichen Forschungen und aus den Ingenieurwissenschaften, vor allem natürlich aus der Informatik gekommen, als aus den sozialwissenschaftlich orientierten Medienwissenschaften, der Sprachwissenschaft und der Soziologie. Die Ursache hierfür dürfte letztlich in den Grundannahmen liegen, die sich über Kommunikation |
(Seite 79) | ||||||||||||
| und Medien in der
Industrie- und Buchkultur herausgebildet haben. Sie waren für die Verhältnisse
der interaktionsfreien Massenkommunikation angemessen, aber sie erweisen
sich zunehmend als Fessel, wenn es darum geht, auf die Anforderungen der
multimedialen Informationsgesellschaft zu reagieren. |
|||||||||||||
| 5. Die Ambivalenz der Informationsverarbeitung und der sie modellierenden Kategorien | |||||||||||||
| Ich möchte zum Abschluß dieses Teils des Vortrags noch auf eine dritte Besonderheit des vorgestellten Konzepts kultureller Informationsverarbeitung hinweisen: Wir kommen in diesem Modell ja im wesentlichen mit zwei Kategorien, Medium oder Speicher und Prozessor oder Informationssystem, aus. Mit der ersteren Kategorie bezeichnen wir alle Phänomene, die Informationen konstant halten mit der zweiten alle jene, die sie verändern. Aber selbst diese Unterscheidung ist relativ und nicht ontologisch zu verstehen. Bei jeder empirischen Analyse kann man die Phänomene sowohl unter dem Gesichtspunkt des Informationserhalts - und damit als Medium oder Speicher - als auch unter dem Gesichtspunkt der Informationsverarbeitung - und damit als Sensor Prozessor, Kommunikator usf. - behandeln. Eine Grundschwierigkeit kommunikationswissenschaftlicher Arbeit besteht gerade darin, diese Doppelgesichtigkeit aller Phänomene im Blick zu behalten. Ja, ich denke sogar, daß der gegenwärtige Ruf nach der Vermittlung von kommunikativen Schlüsselqualifikationen letztlich auch darauf abzielt, entsprechende Formen des ambivalenten Denkens zu entwickeln. Wir brauchen in vielen Bereichen unserer Gesellschaft ein Sowohl-Als-Auch anstatt des alten Entweder-Oder-Denkens. Und genau dieses Denken ist für alle kommunikationswissenschaftlichen Analysen erforderlich: Die Phänomene sowohl als Medium als auch als Prozessor zu begreifen oder, um auf das ursprüngliche Thema dieses Vortrages zurückzukommen, die Gedächtnisleistungen sowohl als Speichern als auch als Verändern/Vergessen begreifen. Das Gedächtnis erscheint dann selbst nicht nur als etwas, daß Informationen konstant hält, sondern eben auch als Zerstörer von Informationen. Damit nehmen wir das vorneuzeitliche Konzept der memoria wieder auf, in dem dieser auch beide Funktionen zugeschrieben wurde. |
(Seite 80) | ||||||||||||
| 6. Konzepte
kultureller Veränderung |
|||||||||||||
| Ich komme damit
zum zweiten Teil meines Vortrags, in dem es um die Dialektik von Krise und
Wandel, von Vergessen und Erinnern gehen soll. Die generelle Frage lautet: Welche Vorstellungen von kultureller Evolution sind für den Kommunikations- und Medienhistoriker sinnvoll? Diese Vorstellungen werden bestimmen, was als Krise und was als Fortschritt, was als vergessene Information überhaupt bemerkt und dann vielleicht bedauert oder begrüßt wird. Ich kann das Thema hier nicht ausführlich behandeln und möchte deshalb die Aufmerksamkeit nur auf einen Punkt lenken, der gerade für das Verständnis unserer Gegenwart von großer Bedeutung ist (4): Die einseitige Prämierung von Prozessen der Systementwicklung und Komplexitätsreduktion und die gleichzeitige Abwertung von Niedergangsphänomenen und von Komplexitätszunahme. Der ökologische und multimediale Ansatz legt es demgegenüber von vornherein nahe, hier nicht nach einem einzigen Konzept zu suchen. Was wir brauchen sind mehrere Modelle von Veränderungen, die sich kombinieren lassen und die gemeinsam oder nacheinander als Repertoire für das Verständnis spezifischer Prozesse zur Verfügung stehen. Es gibt hier eine große Vielzahl von Veränderungskonzepten und einige immer wieder auftauchende sollen kurz aufgelistet werden: |
|||||||||||||
|
(Seite 81) | ||||||||||||
| Ich will auf
die verschiedenen Modelle nicht näher eingehen, sondern sie nur als
Hintergrund für meine Beobachtung benutzen, daß man gegenwärtig
in den Sozial- und Geisteswissenschaften ein deutliches Defizit im Bereich
der Strukturauflösungs- und Chaostheorien - und damit einhergehend
in den einschlägigen empirischen Analysen - feststellen kann. Natürlich hat es Niedergangstheoretiker in den Geisteswissenschaften immer wieder gegeben, aber nur ausnahmsweise konnten sie dem Chaos etwas Positives abgewinnen und in den seltensten Fällen waren sie in der Lage, den Strukturverfall zugleich als einen Neuordnungsprozeß auf einem anderen Emergenzniveau zu verstehen. Sobald sich Systeme auflösen, sei es nun das sozialistische Herrschaftssystem oder Wirtschaftsunternehmen, macht sich Hilflosigkeit breit. Erst langsam beginnt die Unternehmensberatung Auflösungs- und radikalen Umstrukturierungsprozessen nicht mehr zu denunzieren. Aber noch immer traut man sich nicht, z. B. Lehrstühle für Konkursmanagement einzurichten. Stattdessen wird- und dies in Deutschland in den letzten Monaten in beachtlichem Umfang- das Fachgebiet Unternehmens(neu)gründung aus dem Boden gestampft.Blättert man in der vielleicht monumentalsten soziologischen Theorie unserer Zeit, der Systemtheorie Luhmanns, dann stößt man überall auf Beschreibungen der Mechanismen von Komplexitätsreduktion, was nur ein anderer Ausdruck für Struktur- und Systembildung ist, aber eben nicht von Komplexitätsinduktion. Im Gegenteil, auch als Mechanismus der Komplexitätssteigerung kennt diese Theorie wieder nur die Komplexitätsreduktion.(5) In den Natur- und Technikwissenschaften kann ich keine vergleichbare Zurückhaltung bei der Untersuchung und Modellierung von Alterungs-, Niedergangs- u.a. Auflösungsprozessen finden. Chaostheorien spielen in avancierten Zweigen der Physik und Chemie eine wichtige Rolle. Biologen haben ohnehin mit dem Zyklus Geburt, Wachstum, Reife, Altern und Tod zu tun. Und auch in der Technik werden Prognosen darüber erwartet, wann die einzelnen Teile verschlissen sind, in welchen Intervallen Wartungsarbeiten/Erneuerungen vorzunehmen sind. Was also erschwert es sozial- und geisteswissenschaftlichen Theoretikern die Kulturentwicklung als einen Wechsel zwischen Strukturbildung und Strukturauflösung, zwischen Ordnung und Chaos zu begreifen, so wie dies andere Wissenschaften, die die lebende Natur zum Gegenteil haben, ganz selbstverständlich tun? (Vgl. Abb. 6) |
(Seite 82) | ||||||||||||
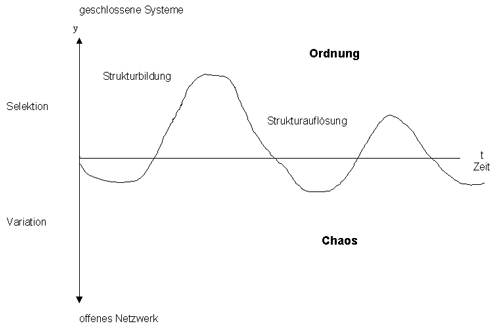 Abb. 6: Veränderung als Systementwicklung und -auflösung |
|||||||||||||
| Ich denke, daß
eine ganz wichtige Ursache für dieses verkürzte Verständnis
von kultureller Entwicklung in der ideologischen Selbstbeschreibung der
Buch- und Industriekultur zu suchen ist, zu der wiederum die Geisteswissenschaften
die meisten Beiträge geliefert haben. Als typische Errungenschaften
der Neuzeit werden drei Programme gefeiert: Aufklärung und Verwissenschaftlichung,
Technisierung und Industrialisierung, sowie marktwirtschaftliche Vernetzung
und Demokratie. Die Aufklärung will alle Formen kultureller Information in eine sprachlich explizite Form bringen, neue Informationen so sammeln, daß sie möglichst für jedermann an jedem Ort zu allen Zeiten (allgemein) gültig sind und beide Formen von Informationen dann medial so präsentieren, daß sich möglichst viele Menschen dieses Wissen aneignen können. 'Wo Es ist, soll Ich werden!' (Freud), 'Nur was in klaren, gemeinverständlichen Aussagen im Druck veröffentlicht ist, kann wahr sein' (Libavius), 'Nur die Freiheit der Meinungsäußerung sichert den Fortschritt der Wissenschaften'. Vom Standpunkt einer ökologischen Informationstheorie aus betrachtet, erweist sich das Konzept der Aufklärung freilich als ziemlich einseitig und wenig demokratisch. Es geht letztlich um eine Hierarchisierung von Informationstypen, Prozessoren und Medien. Die höhere (vernünftige) Bewußtseinstätigkeit des Menschen, standardsprachliche Kodierungen und das typographische Massenmedium |
(Seite 83) | ||||||||||||
| sollen gegenüber
allen anderen Formen der Informationsverarbeitung und -speicherung bevorzugt
werden. Auf die Übersetzung von Informationen in dieses System werden
Prämien ausgesetzt. Und die Aufgabe der Geistes- und Sozialwissenschaftler
besteht zu großen Teilen darin, diese Wertvorstellungen zu legitimieren. Für die Akkumulation von 'wahrem Wissen' in diesem Medium gibt es andererseits keine Grenzwerte. Je mehr desto besser! Kein Ziel der Aufklärung ist demgegenüber die Bewahrung der Vielfalt der informativen Arten, das gleichberechtigte Miteinander der verschiedenen Typen von Informationsverarbeitung im kulturellen Kreislauf und die allseitige Nutzung der Ressourcen der verschiedenen Systeme. Wieso setzt man nicht die Geschicklichkeit (tacit knowledge), warum nicht die Intuition und die emotionale Intelligenz auf den Thron, und wieso lobt man nicht die Einzigartigkeit von Weisheit, die sich nicht massenhaft reproduzieren läßt? Das Programm der Technisierung und der massenhaften identischen Reproduktion von Waren und Information, also der Industrialisierung birgt ähnliche Gefahren in sich, wenn es zum einzigen Kriterium des Fortschritts gemacht wird. "Technik und Ökonomie haben in der Industriegesellschaft den Takt, die mechanische Wiederkehr des Gleichen, an die Stelle der rhythmischen Gliederung des Werdens und Vergehens gesetzt."(6) Diese Entrhythmisierung schafft nicht nur lineare Entwicklungsmodelle, sie führt zugleich auch zu ökologischen Ungleichgewichten: "Wollen wir ökologisch sinnvoll handeln, dann gehört dazu .... das Erkennen von natürlich Rhythmen, das Akzeptieren dieser und deren Schonung." (Ebd. S. 129) Zweifellos ist die Industrialisierung eine kulturelle Errungenschaft, aber es widerspricht dem multimedialen Charakter unserer Kultur, nur diese Dimension zum Maßstab zu nehmen. Dies gilt auch und gerade für die Kommunikationswissenschaft. Zumal in Deutschland beschäftigt sie sich nahezu ausschließlich mit den verschiedenen Formen technisierter Massenkommunikation. Das unmittelbare Gespräch von Angesicht zu Angesicht in Gruppen und Teams hat nicht im Entferntesten soviel Aufmerksamkeit erlangt, wie die interaktionsfreie Massenkommunikation. Es gibt aber aus der ökologischen Perspektive betrachtet keinerlei Veranlassung, monomediale, höchstens bimediale Kommunikationsformen mit meist sehr schwachen Rückkopplungskreisen, wie diese für den Buch- und Zeitungsmarkt, Film, Funk und Fernsehen |
(Seite 84) | ||||||||||||
| typisch sind, anderen
multimedialen und hochgradig vernetzten Kommunikationssystemen vorzuziehen.
Damit sind wir auch bei den Grenzen des dritten Programms angelangt, auf das die europäische Neuzeit eine hohe Prämie ausgesetzt hat, die marktwirtschaftlichen Vernetzungsmechanismen. Selbstverständlich handelt es sich hierbei um eine wichtige Vernetzungsform. Aber sie ist nicht die einzige, sie muß mit institutionellen hierarchischen, binär schematisierten interaktiven und vermutlich noch einer Reihe von weiteren Vernetzungsmechanismen zusammenwirken, um eine Kultur zu schaffen. Zusammenfassend kann man sagen, daß die Mystifizierung der unbestreitbaren Leistungen der Buchkultur, also die einseitige Bevorzugung einiger weniger Typen von Informationsmedien, von Informationsverarbeitung, kommunikativer Vernetzung und von Entwicklung aus dem riesigen Arsenal unserer Kultur ein angemessenes Verständnis derselben und ihre Opitimierung erschweren. Sie hierarchisiert grundsätzlich wo, zumindest in unserer Gegenwart, ein gleichberechtigtes Miteinander und eine punktuelle Hierarchisierung in spezifischen Situationen zu empfehlen wäre. |
|||||||||||||
| 7. Welche Konsequenzen ergeben sich hieraus für die Erforschung kultureller Kommunikation? |
|||||||||||||
| Wenn wir die
Kultur als ein multimediales Netzwerk unterschiedlicher Arten von Informationssystemen/Kommunikatoren
begreifen wollen, dann müssen wir die Bedeutung von Grundwerten der
Industrie- und Buchkultur relativieren. Erforderlich sind völlig
andere Erkenntnis- und Kommunikationstheorien, als jene, die seit der
Renaissance vor allem deshalb entwickelt wurden, um Fragen, die sich aus
der typographischen Informations- und Kommunikationstechnologie ergaben,
zu beantworten. Wir werden nicht nach einer sondern nach mehreren Wahrnehmungs-,
Medien- und Vernetzungstheorien suchen müssen, die nicht bloß
zum Verständnis monomedialer sondern eben auch von multimedialer
und interaktiver Informationsverarbeitung beitragen. Spätestens an dieser Stelle muß ausdrücklich auf das Gespräch eingegangen werden. Ohne eine Beschäftigung mit dieser Form der Kommunikation von Angesicht zu Angesicht zwischen mehreren Menschen bei gemeinsamer Arbeit als dem bislang komplexesten Fall einer multimedialen und rückkopplungsintensiven |
(Seite 85) | ||||||||||||
| Verständigung
werden uns zeitgemäße Kulturdiagnosen schwerlich gelingen. Diese
Kommunikationsform läßt noch immer bei weitem die vielfältigsten
Formen von Informationsverarbeitung und -darstellung zu, und sie erscheint
auch bis auf absehbare Zeit die einzige Instanz zu sein, die die erforderliche
Komplexität besitzt, um die unterschiedlichen Informationen, die für
die menschliche Kultur wichtig sind und die sie in den verschiedenen Medien
speichert, wieder zusammenzuführen. Ihre Bedeutung als Integrationsinstanz
ist sogar historisch in dem Maße gewachsen, in dem durch die Technisierung
monomediale Informations- und Kommunikationssysteme entstanden sind. Das unmittelbare Gespräch bietet ein Paradigma für simultane Parallelverarbeitung unterschiedlicher Typen von Informationen durch unterschiedliche Prozessoren/Kommunikatoren und somit für die Analyse von Ökosystemen. Es ist ungemein rückkopplungsintensiv und steuert sich selbst. Die für die Zukunft der Informationsgesellschaft unter dem Vernetzungsaspekt entscheidende Frage: Was kommt nach und zusätzlich zu Markt und Hierarchie als Verteilungsmechanismen? wird ohne ein besseres Verständnis der verschiedenen Typen egalitärer Gruppengespräche nicht zu beantworten sein. Um die neu entstehenden Formen auch digitaler Informationsverarbeitung zu verstehen und zu gestalten, ist der Blick auf Gruppengespräche m. E. sinnvoller als die Orientierung an der interaktionsfreien technisierten Massenkommunikation. Es geht ja in den neuen Medien gerade um eine Erhöhung von Interaktivität, Parallelverarbeitung und Multimedialität. Die Orientierung auf das Gruppengespräch erleichtert es auch, die im Maßstab von Institutionen/Betrieben und Gesellschaften so bedrohliche Erscheinung der Systemauflösung mit mehr Gelassenheit zu betrachten: Gruppen und Gruppengespräche entstehen, reifen und vergehen, ohne daß wir dies als Katastrophe erleben. Wir sind frei, die Ergebnisse im Gedächtnis zu behalten und frei, uns anderen Gruppen zuzuwenden. |
|||||||||||||
| Zusammenfassung |
|||||||||||||
|
(Seite 86) | ||||||||||||
|
(Seite 87) | ||||||||||||
| 8. Anmerkungen |
|||||||||||||
|