| Der Dreieckskontrakt | |
| Die kommunikative Sozialforschung versteht
die Beziehungen innerhalb eines Forschungssystems als kommunikative Beziehungen.
Dabei sind als zentrale Bestandteile eines Forschungssystems verschiedene
Handlungsakteure zu identifizieren. Dies gilt umso mehr, wird wissenschaftliche
Forschung projektorientiert und mittels Projektmanagement gesteuert verstanden.
Die wesentlichen Handlungsakteure in einem Forschungssystem sind, in Anlehnung
an das klassische Projektmanagement, der Auftraggeber einer Forschungsarbeit,
ein zu untersuchendes System und das Forscherteam. |
|
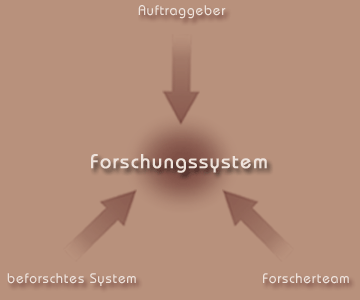 |
|
| Abb. 1: Elemente des Forschungssystems | |
| Der Auftraggeber wird in der Regel innerhalb eines solchen Systems die (Erkenntnis-)Ziele der Forschung definieren und stellt die notwendigen Ressourcen zur Zielerreichung zur Verfügung. Das vom Auftraggeber beauftragte Forscherteam versucht das Erkenntnisinteresse des Auftraggebers in ein Forschungsprogramm umzusetzen. Das zu beforschende System kann entweder auch vom Auftraggeber vorgegeben werden bzw. Forscherteam und Auftraggeber verständigen sich über das zu beforschende System. Alle drei Teilelemente des Forschungssystems stehen in kommunikativer Beziehung zueinander. Die kommunikative Sozialforschung geht gerade davon aus, dass sobald Menschen in Kontakt zueinander treten, sie sich in eine (wie auch immer geartete) kommunikative Beziehung zueinander begeben. Wird in der klassischen sozialwissenschaftlichen Forschung (vor allem in der quantitativ-statistisch arbeitenden Sozialforschung) der Versuch unternommen, eine möglichste „beziehungslose“ Forschung zwischen Forscherteam und beforschtem System zu erreichen, sieht die kommunikative Sozialforschung gerade in der kommunikativen Beziehung zwischen den Teilelementen des Forschungssystem einen wertvollen Erkenntnisgewinn. Letztlich steht dahinter auch die Annahme, dass 'alle Wissenschaft eine hermeneutische Komponente einschließt’ (vgl. Hans-Georg Gadamer „Wahrheit und Methode“). Letztlich können sich die Menschen, so also auch die Forscher, nur mittels Sprache verständigen, wobei die jeweils andere ’Sprechleistung’ vom (Zu-)Hörer interpretiert werden muss (Hermeneutik). In diesem Sinne legt die kommunikative Sozialforschung großen Wert auf die Organisation der (kommunikativen) Beziehungen innerhalb des Forschungssystems. Sollen diese Beziehungen zwischen Auftraggeber, Forscherteam und beforschtem System gewinnbringend genutzt werden, müssen diese Beziehung klar herausgearbeitet und mittels Verträge eindeutig beschrieben werden. Diese Verträge, die in Form eines Dreieckskontraktes zusammengefasst werden, müssen zu Beginn der Forschung quasi als konstituierend für das Forschungssystem ausgehandelt und formuliert werden – ohne Dreieckskontrakt kein Forschungssystem! Der Dreieckskontrakt ist als konstitutives Element des Forschungssystems das emergente Produkt dreier bilateraler, aufeinander abgestimmter Verträge. Zum Einen muss die Beziehung zwischen Auftraggeber und Forscherteam in einem solchen Vertrag geregelt werden. Zum Anderen muss der Auftraggeber n eine vertraglich geregelte Beziehung mit dem zu untersuchenden System eintreten. Da sozialwissenschaftliche Forschung heute meist projekt- und Team orientiert erfolgt, wie es von der kommunikativen Sozialforschung ausdrücklich empfohlen und gefordert wird, muss sich des Weiteren auch das Forscherteam vertraglich konstituieren. Unter Umständen kann es auch erforderlich sein, dass das Forscherteam und das beforschte System in eine direkte vertragliche Beziehung eintreten, so dass aus einem Dreieckskontrakt auch eine Quasi-Vierecksbeziehung erwachsen kann. Innerhalb der Vertragsgestaltungen müssen vor allem die verschiedenen Elemente des Forschungssystems in ihrer Rolle und Funktion eindeutig bestimmt werden. Dies ist um so bedeutender, wenn dieselben Handlungsakteure in mehrfacher Hinsicht im Forschungssystem auftreten. So ist es in der Forschung häufig der Fall, dass der Auftraggeber auch Teil des beforschten Systems sein kann. Dies ist meist dann der Fall, wenn eine Organisation (Unternehmen, Verband, Behörde etc.) bspw. über seine interne Kommunikation beraten werden möchte und im Verlauf der Forschung der Auftraggeber (z.B. Abteilungsleiter Unternehmenskommunikation) selber als Interviewpartner, somit als Teil des beforschten Systems, zur Verfügung steht. Im gesamten Beratungswesen und der sich in diesem Bereich angesiedelten sozialwissenschaftlichen Forschung stellt diese Konstruktion die eher typische Situation des Forschungssystems dar. Insbesondere gewinnt die Konstitution eines Forschungssystems in Form eines Dreieckskontraktes innerhalb der hochschulwissenschaftlichen Ausbildung zunehmend an Bedeutung. So ist im B.A.-Studium Kommunikationswissenschaft des Seminars für Medien und Kommunikation der Universität Erfurt integraler Bestandteil, dass die Studierenden zum Abschluss ihres Studiums eine zweisemestrige Projektstudienphase zu durchlaufen haben. Hier werden die Studierenden auch mit der Problematik des Dreieckskontraktes konfrontiert. Auf die diesbezüglichen Besonderheiten soll im Folgenden nähe eingegangen werden. |
|
| Der Dreieckskontrakt im Rahmen der Hochschullehre | |
| Insbesondere soll eine Projektstudienphase
innerhalb eines B.A.-Hochschulstudiums der Vermittlung bzw. Vertiefung von
wissenschaftlichen sowie berufsrelevanten Qualifikationen dienen. Dazu bedarf
es auch der Vermittlung praxisrelevanter Fertigkeiten und Kenntnisse. Also
sind in diesem Kontext die Studierenden oftmals bemüht, sich ein eher
praxisorientierte Fragestellung zu überlegen, die im Idealfall in konkrete
Forschungsergebnisse (z.B. Neugestaltung einer Homepage, Neukonzeption der
Mitarbeiterkommunikation, Leseranalyse eines Magazins etc.) münden
soll. Bei solcher Art von Projekten stellen sich mehrere Besonderheiten, die in der Vertragsgestaltung unbedingt zu berücksichtigen werden müssen. Insbesondere stellt sich die Problematik des Auftraggebers. Solange (studentische) Projekte im Rahmen einer hochschulwissenschaftlichen Ausbildung organisiert werden, muss als Auftraggeber die Hochschule bzw. der betreffende Dozent/Betreuer definiert werden, denn schließlich veranlasst und fordert die Hochschule mittels ihrer Studien- und Prüfungsordnung diese Art von projektbezogenem Studium. Im Rahmen einer Projektstudienphase ist es aber auch notwendig, dass sich die studentischen Projektgruppen eine Institution (außerhalb der Hochschule) als zu untersuchendem System suchen müssen.(1) Häufig tritt dem Forscherteam ein „Projektpartner“ gegenüber, der aus einem zweiten (Quasi-)Auftraggeber und dem eigentlich zu untersuchenden System besteht. Es kann dann notwendig werden, dass das Forscherteam noch weitere vertragliche Vereinbahrungen mit dem Ziel trifft, Rechte und Pflichten der Subsysteme des Projektpartners untereinander und gegenüber dem studentischen Forscherteam zu klären. Das Forscherteam hat dann zwei Auftraggeber und dadurch unterschiedliche Leistungen zu erbringen. Die Leistungen, die vom Forscherteam dem Projektpartner gegenüber erbracht werden, können nicht Gegenstand der Beurteilung der Hochschullehrer sein. Für diese ist jedoch eine klare Benennung der Leistungen des zu untersuchenden Subsystems wichtig. Der externe Projektpartner hat als Auftraggeber eine ähnliche Stellung wie der Anbieter eines Praktikums für Studierende. Es kann also u. U. sinnvoll sein, wenn die Hochschule Praktikumsverträge mit solchen Partnern abschließt. Eventuelle Vergütungen sind separat zwischen dem Projektanbieter und den Studierenden zu regeln. Die Rückkopplung der Studierenden an den externen Auftraggeber kann unter diesen Umständen als Praktikumsbericht (evtl. als Projektverlaufsbericht konzipiert) akzeptiert und gewertet werden. Ganz gleich ob die Studierenden als „Forscherteam“ oder als „Praktikanten“ auftreten bzw. Dienstleistungen für den externen Auftraggeber erbringen, in beiden Fällen bleiben sie Angehörige der Universität. Diesem Vorrang der Hochschule als primärer Auftraggeber im Forschungssystem „studentischer Projekte“ ist dementsprechend Rechnung zu tragen.(2) Diese Komplexität in der Konstituierung des Forschungssystems, die in der „normalen“ Forschung so meist nicht zu erwarten ist, muss durch einen entsprechenden Dreieckskontrakt aufgefangen werden. Betrachtet man die Projektstudienphase im kommunikationswissenschaftlichen Studium der Universität Erfurt stehen drei Verträge im Vordergrund, welche nachfolgend erläutert werden sollen: |
|
| 1. | ein Vertrag zur Konstitution des Forscherteams |
| 2. | ein Vertrag zwischen der Universität (Auftraggeber) und dem Forscherteam und |
| 3. | ein Vertag zwischen der Universität (Auftraggeber) und dem zu untersuchenden System (Projektpartner) bzw. ergänzt um einen Vertrag zur Projektbeschreibung und Aufgabendefinition zwischen Forscherteam und dem zu untersuchenden System (Projektpartner). |
Die Reihenfolge der hier besprochenen Verträge sollte aber nicht als chronologische Abfolge im Projektmanagement begriffen werden, in welcher die Verträge in dieser Reihenfolge nacheinander abgehandelt werden. Vielmehr, und das macht u. A. die Komplexität Projekt orientierter Forschung aus, werden diese Verträge zeitgleich und oftmals nicht durchgängig „an einem Stück“ verhandelt. Da wird der Entwurf des einen Vertrages noch geschrieben, da laufen auf anderer Seite schon Nachverhandlungen zu einem bereits geschlossenen Vertrag. Bis letztlich alle relevanten Verträge abgeschlossen werden können und mit dem Dreieckskontrakt das Forschungssystem konstituiert ist, hat das betreffende Projekt meist längst begonnen, da ansonsten Sach-, Finanz- und Zeitziel des Projektes in Gefahr geraten können. So gestaltet sich die erste Phase der Projekt-Forschung oftmals aus einem Ineinandergreifen von Projekt- und weiterer Vertragsgestaltung sowie der eigentlichen inhaltlichen Arbeit. (3) |
|
| 1. Kontrakt Forscherteam | |
| Ein Forscherteam besteht im Rahmen des hier
besprochenen Forschungssystems aus mind. zwei Personen. Zuerst sollte die
Frage geklärt werden, in welcher (rechtlich-organisatorischen) Form
sich ein studentisches Forscherteam konstituieren kann. |
|
 |
|
| Abb. 2: Konstitution Forscherteam | |
| Durch den Zusammenschluss von mind. zwei Personen zur Verfolgung eines gemeinsames Zweckes bildet sich, auch ohne eine ausdrückliche Willenserklärung, eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) – §§ 705-740 BGB. Ein solcher Zusammenschluss im Form einer GbR ist auch ohne einen schriftlichen Gesellschaftsvertrag gegründet. Für die praktische Arbeit ist es sinnvoll die wesentlichen Ziele und Aufgaben der Gesellschaft sowie die wesentlichen Rechte und Pflichten der Gesellschafter (also der beteiligten Studierenden im Forscherteam) schriftlich niederzulegen, um eine Nachvollziehbarkeit und Überprüfbarkeit der getroffenen Vereinbahrungen zu gewährleisten. Als Beispiel für eine solche vertragliche Vereinbahrung des Forscherteams kann der Gesellschaftsvertrag des Projektes „Interne Unternehmenskommunikation GbR“ dienen (Anlage 1). Dieses Forscherteam untersuchte die internen Kommunikationsabläufe in einem internationalen Versicherungskonzern. Folgende regelungsrelevante Inhalte sollte ein solcher Gesellschafts-Vertrag enthalten: |
|
| Name und Zweck der Gesellschaft | |
| Bezeichnung der Gesellschafter | |
| Dauer der Gesellschaft | |
| Finanzierung (Einlagen) der Gesellschaft | |
| Hinweise zu Gesellschafterbeschlüssen | |
| Außenvertretung und Haftung der Gesellschaft | |
| Angaben zu einer möglichen Gewinnverteilung. | |
Eine rechtliche Besonderheit bei GbRs ist allerdings zu beachten. Normalerweise haften in einer GbR alle Gesellschafter mit ihrem Geschäfts- als auch mit ihrem Privatvermögen gesamtschuldnerisch. Soll die Haftung der Gesellschafter lediglich auf das Gesellschaftsvermögen beschränkt werden, bedarf dies einer expliziten, schriftlichen Erklärung der Gesellschaft. Diese Haftungsbeschränkung wird aber nur rechtswirksam, wenn sie dem jeweiligen Vertragspartner ausdrücklich mitgeteilt wird und dieser in diese Erklärung einwilligt. Diese Haftungsregelungen sollten in der Konstitution des Forscherteams unbedingt Beachtung finden. Diese Form der Konstitution macht deutlich, dass die Studierenden ihr betreffendes Projekt als gemeinsam Handelnde durchführen. Soweit die entsprechenden Studien- und Prüfungsordnungen der Hochschule keine Gruppenarbeiten vorsehen, muss letztlich die Bewertung der Studierenden einzeln erfolgen. Dazu ist sicherzustellen, dass einzeln bewertbare Projektergebnisse (z.B. genau bezeichneter Teil des Projektergebnisberichtes o. ä.) vorliegen. Eine diesbezügliche Regelung kann ebenso Teil des Gesellschaftsvertrages werden. |
|
2. Vertrag zwischen Universität (Auftraggeber) und Forscherteam |
|
| In der Form der hier beschriebenen Projekt orientierten studentischen Forschung muss gewährleistet sein, dass zur erfolgreichen Durchführung der Projekte die weitere wissenschaftliche Qualifizierung der Studierenden sichergestellt wird. Insbesondere muss neben der Projektdurchführung Sorge getragen werden, dass die Studierenden zu ihrem wissenschaftlichen Abschluss geführt werden, der gewisse fachliche Qualifikationen (hinsichtlich Theorie und Methode) verlangt. Diese Wissensvermittlung muss im Vordergrund der Projekte stehen. | |
 |
|
| Abb. 3: Vertrag zwischen Auftraggeber (Universität) und Forscherteam | |
Diesbezüglich ist eine vertragliche Vereinbahrung zwischen Hochschule/Dozent als Auftraggeber und Forscherteam notwendig. Zwar besteht hier in Form der jeweiligeren Prüfungs- und Studienordnungen eine grundsätzliche vertragliche Vereinbahrung über die wissenschaftliche Ausbildung der Studierenden. Jedoch ist es sinnvoll, für die einzelnen Projekte zusätzliche Verträge abzuschließen, in denen das konkrete Ziel und der wissenschaftliche wie methodische Umfang des Projektes beschrieben und festgehalten werden. Solch ein Vertrag kann insbesondere den Studierenden als ein quasi „Roter Faden“ durch das Projekt leiten und schafft so die notwendige Grundlage dafür, dass Sach-, Kosten- und Zeitziel des Projektes erreicht werden können. Als Beispiel kann der in der Anlage 2 aufgeführte Vertrag dienen. Folgende typische Inhalte sollte der Vertrag zwischen Auftraggeber und Forscherteam enthalten: |
|
| nähere Projektbeschreibung (z.B. anzuwendende Theorie bzw. Methode) | |
| Fallzahlen in der empirischen Untersuchung | |
| Nutzung der Infrastruktur der Hochschule (z.B. Büro-, Telefon-, Kopierkosten etc.) | |
| gegenseitige Rechte und Pflichten | |
| Vertragsdauer | |
| Umgang mit Datenmaterial (insbesondere Verwertungs- und Nutzungsrechte). | |
Außerdem kann dieser Kontrakt auch als eine Art Garantie zur wissenschaftlichen Betreuung des studentischen Forscherteams gegenüber dem außeruniversitären Projektpartner gelten. Solch eine Zusage der Universität kann u. U. notwendige Voraussetzung sein, damit ein externer Partner sich auf ein solches Projekt, was für ihn auch immer ein Stück Experiment bedeutet, einlässt und vom Erfolg eines solchen Vorhabens ausgehen kann. Somit kann der Kontrakt zwischen der Hochschule und dem Forscherteam von Seiten des Projektpartners als eine Art Betreuungsvereinbahrung aufgefasst werden. |
|
| 3. Vertrag zwischen Universität (Auftraggeber) und beforschtem System (Projektpartner) | |
| Mit den beiden erst genannten Kontrakten werden
in dieser Konstruktion studentischer Forschung die notwendigen Rahmenbedingungen
hinsichtlich der wissenschaftlichen Ausbildung geschlossen. Um solcher Art
Projekt überhaupt durchführen zu können, bedarf es natürlich
einem zu beforschenden System – dem Projektpartner. Auch hier bietet
es sich an mit dem Projektpartner einen schriftlichen Vertrag abzuschließen.
Hier muss insbesondere der Umfang des zu untersuchenden Systems (Stichprobe),
der Umgang mit dem Datenmaterial, datenschutzrechtliche Bestimmungen und
die weiteren gegenseitigen Rechte und Pflichten geklärt werden. |
|
 |
|
| Abb. 4: Vertrag zwischen Auftraggeber (Universität) und beforschtem System | |
Zu einer erhöhten Komplexität in dieser vertraglichen Gestaltung kann es kommen, wenn der Projektpartner nicht nur als zu untersuchendes System, sondern in gewisser Weise auch als (zweiter) Auftraggeber neben der Hochschule auftritt. Dies ist immer dann der Fall, wenn der Projektpartner eigene Vorstellungen hinsichtlich dem Erkenntnisziel des Projektes entwickelt. Sobald dies der Fall ist, muss im Kontrakt eine klare Rollendefinition erfolgen, wann und in welchem Zusammenhang vom untersuchten System oder vom (zweiten) Auftraggeber die Rede ist. Beim Forscherteam liegt die Aufgabe, die möglichen unterschiedlichen Zielvorstellungen der Hochschule als Auftraggeber und des Projektpartners als untersuchtes System einander anzunähern und ggf. zu harmonisieren. Unter bestimmten Umständen kann das aber auch dazu führen, dass das Forscherteam im Verlauf des Projektes teils unterschiedliche Forschungsziele verfolgen muss. Dies sollte aber von der Hochschule als eigentlichem Auftraggeber genau beobachtet werden. Denn schließlich streben alle Teilnehmer des Forscherteams zuerst einen wissenschaftlichen Hochschulabschluss an. Deshalb sollten die Teammitglieder auch im Großen und Ganzen gemeinsam die selbe Aufgabenstellung bearbeitet haben. Ein Auseinanderbrechen des Forscherteams in einen Teil, der für die Hochschule arbeitet und in einen weiteren Teil, der für den Projektpartner (als zweiten Auftraggeber) tätig ist, muss unbedingt verhindert werden. Insgesamt betrachtet sind folgende wesentliche Gesichtspunkte im Vertrag zwischen Universität/Forscherteam und dem Projektpartner regelungsrelevant: |
|
| Beschreibung des Vertragsgegenstandes | |
| Projektdauer, Projektplanung, Projektphasen | |
| Rechte, Pflichten des Forscherteams | |
| Rechte, Pflichten des Projektpartners | |
| Arbeitsrechtliche, versicherungsrechtliche etc. Verhältnisse zwischen FT und Projektpartner klären | |
| Ansprechpartner benennen | |
| Übernahme von Kosten und Finanzierung des Projektes klären | |
| Rechte an den Forschungsergebnissen bzw. am Arbeitsprodukt klären (z.B. Veröffentlichungsrecht, Eigentumsrecht etc.) | |
| Sonstige Bestimmungen (Datenschutz, beschränkte Haftung der GbR etc.) | |
Aufgrund der zahlreichen Besonderheit studentischer Projekte wird an dieser Stelle deutlich, dass es sich bei diesem Vertrag wohl um den komplexesten Vertrag innerhalb des Dreieckskontrakte handelt. Besondere Sorgfalt ist hier gefordert, um den Erfolg des Projektes zu garantieren. Als Beispiel soll hier der Projektvertrag der Projektgruppe „Interne Unternehmenskommunikation GbR“ mit ihrem Projektpartner dienen (Anlage 3). |
|
| 4. Ergänzende Hinweise | |
| Hinsichtlich der Ausrichtung in B.A.-Studiengängen
und in praxisorientierten M.A.-Studiengängen sind zwei wesentliche,
von einander zu differenzierende Projekttypen zu erwarten. Zum einen gibt
es mehr wissenschaftlich-theoretisch ausgerichtete Projekte und zum anderen
gibt es Projekte, die an der Lösung von Problemen in einschlägigen
Berufen mit wissenschaftlichen Verfahren orientiert sind. Dies ergibt sich
aus den durch die Hochschulgesetzgebung vorgegebenen Rahmenbedingungen.
Je stärker der forschungsorientierte Ansatz zugunsten der Berufsfeldorientierung
zurücktritt, desto stärker nähern sich die Projekte den Praktika,
wie sie etwa aus der Lehrerbildung bekannt sind, an. Der Hochschullehrer
wird zum „Betreuer“, die Abschlussarbeit der Studierenden zu
einem Praktikumsbericht. Wie diese Konstellation in den Studien- und Prüfungsbetrieb
einzubauen ist, dafür fehlen gegenwärtig an den Universitäten
noch die notwendigen Erfahrungen. Hierzu stellt die Kultusministerkonferenz (KMK) in ihren „10 Thesen zur Bachelor- und Masterstruktur in Deutschland“ (KMK-Beschluss vom 12.06.2003 (4)) fest: „Die Einführung einer gestuften Studienstruktur mit Bachelor- und Masterstudiengängen ist ein zentrales Anliegen deutscher Hochschulpolitik. Mit ihr verbindet sich eine weitreichende organisatorische und inhaltliche Reform der Studiengänge, die zu einer stärkeren Differenzierung der Ausbildungsangebote im Hochschulbereich führt. Gestufte Studiengänge eröffnen ein Studienangebot, das von Studienanfängern, Studierenden und bereits Berufstätigen flexibel entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen nach Qualifikation genutzt werden kann. Sie tragen damit zu kürzeren Studienzeiten, deutlich höheren Erfolgsquoten sowie zu einer nachhaltigen Verbesserung der Berufsqualifizierung und der Arbeitsmarktfähigkeit der Absolventen bei. [...].“ Insbesondere bezüglich der Praxisnähe des reformierten Studiensystems formuliert die KMK in These 2 (‚Gestufte Studienstruktur’): „Als erster berufsqualifizierenden Abschluss ist der Bachelor der Regelabschluss eines Hochschulstudiums und führt damit für die Mehrzahl der Studierenden zu einer ersten Berufseinmündung.“ Dementsprechend sollen künftige Masterstudiengänge nach den Profiltypen „stärker anwendungsorientiert“ und „stärker forschungsorientiert“ (vgl. dazu These 4 `Profiltypen’) differenziert werden. Diesen Zielformulierungen der KMK muss in der Konzeption der hier besprochenen Projekte Rechnung getragen werden. Entsprechend der möglichen Ausrichtungen der Projekte müssen in der Vertragsgestaltung unterschiedliche Schwerpunkte gelegt werden. So muss bei den stärker wissenschaftlich-theoretisch ausgerichteten Projekten der Fokus in der Vertragsformulierung zwischen der Hochschule als Auftraggeber und dem Forscherteam liegen. Hingegen liegt der Fokus bei den eher praktisch ausgerichteten Forschungsprojekten auf dem Kontrakt mit dem Projektpartner, da es sich bei dieser Art von Projekten meist um ein konkretes Arbeitsprodukt als Projektergebnis geht. Diese Zieldefinition findet im Kontrakt zwischen Auftraggeber/Forscherteam und untersuchtem System, also dem Projektpartner, statt. Bei diesen Projekten ist allerdings zu beachten, dass es hier quasi zwei Auftraggeber gibt – die ausbildende Hochschule und der Arbeitsprodukt orientierte Projektpartner. Dieser Umstand lässt ein höheres Maß an Komplexität in der Projektsteuerung erwarten. Bei den wissenschaftlich ausgerichteten Projekten bleibt die Hochschule eindeutig der alleinige Auftraggeber. |
|
| (1) Das zu lösende Problem bzw. die zu beantwortende Fragestellung wird vom Forscherteam an den Projektpartner als mögliches zu untersuchendes System herangetragen, d.h. die studentische Projektgruppe hat eine konkrete wissenschaftliche Interessenslage, die es zu lösen gilt. |
| (2) Anders sieht es aus, wenn die Studierenden als Privatpersonen Verträge mit externen Auftraggebern abschließen und für diese quasi in ihrer studienfreien Zeit arbeiten. Dann freilich ist auch die Nutzung universitärer Einrichtungen genehmigungspflichtig. |
| (3) An diese Stelle soll betont werden, dass Forschung im Projektkontext neben der inhaltlichen Arbeit eines permanenten Projektmanagements bedarf. |
| (4) Siehe auch: http://www.kmk.org/doc/beschl/BMThesen.pdf. |