|
|
Pflanzen als Medium kultureller Kommunikation - der Spiegelungsansatz
|
|
|
| In den Naturwissenschaften wird die informationstheoretische
Perspektive auf Pflanzen gegenwärtig bevorzugt. Sie erscheinen als
informationsverarbeitende Systeme und als Informationsmedien. Man kann genauso gut in der strukturellen Dimension ansetzen und sich mit den Vernetzungsmechanismen und der Frage, wie sich die Pflanzen untereinander synchronisieren beschäftigen. (Vgl. das Phänomen des ‚Bambussterbens') Die dritte, spiegelungstheoretische Dimension, die mit der Theorie morphogenetischer Felder von R. Sheldrake bislang nur am Rande berührt wurde, findet sich auch in kulturwissenschaftlichen Arbeiten. Ich werde diese Sichtweise auf die Beziehung der Pflanzen zur menschlichen Kultur anwenden. Resonanz oder Wechselwirkung ist das mindeste was aus kommunikationstheoretischer Sicht erforderlich ist, um von einer kommunikativen Beziehung zu reden. Und das Ergebnis einer solchen Beeinflussung ist immer die Schaffung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden. Wir imitieren das Verhalten unserer Mitmenschen um zu lernen. Wir hoffen, daß unsere Beschreibungen in dem Mitmenschen ähnliche Vorstellungen hervorrufen, wie wir sie selbst entwickelt haben. Der Umgang mit Pflanzen verändert unseren Körper und unsere Psyche. Wir stellen uns auf den Rhythmus von Säen, Pflanzenwachstum und Ernte ein und gestalten unser Leben entsprechend. Andererseits bedeutet jede Kultivierung der Natur deren Zurichtung auf unsere Sinne, Verdauungsorgane, Verhaltensmöglichkeiten usf. Die kultivierten Pflanzen spiegeln uns Menschen. Pflanzen werden seit altersher in das kulturelle System aufgenommen - aber nicht alle und nicht alle in der gleichen Weise. Die ‚Kultivierung' der Pflanzen hängt (u.a.) von den Gemeinsamkeiten ab, die die Menschen in der kulturellen Selbstbeobachtung zwischen sich und den Pflanzen feststellen können. Wie bei allen Spiegelungsverhältnissen müssen wir zwischen positiven und negativen Spiegelungen unterscheiden, also zwischen Ähnlichkeiten und Verkehrungen, Symmetrien und Asymmetrien. Kulturen haben also die Möglichkeit in der Beziehung Mensch : Pflanze die Gemeinsamkeiten oder aber die Unterschiede zu betonen. In der Vor- und Frühgeschichte hat man ganz generell die Gemeinsamkeiten hervorgehoben. Mit der zunehmenden Verstädterung, Industrialisierung, Demokratisierung, also im Prozeß der Zivilisation sind die Unterschiede stärker hervorgetreten.1 In unserer Gegenwart eröffnet sich die Möglichkeit, das Entweder-Oder-Denken durch ein Sowohl-Als-Auch-Denken abzulösen. Diese entwicklungsgeschichtliche Hypothese stellt die nachfolgende Abbildung dar: |
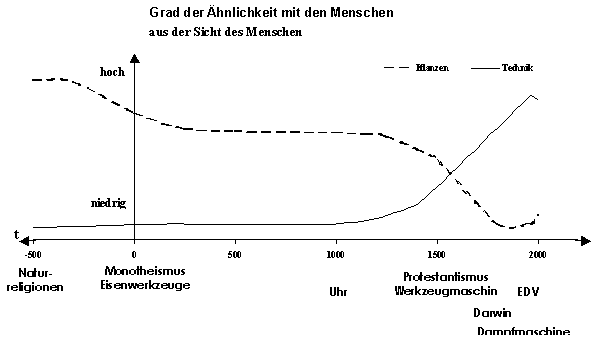 |
| Pflanzen und Technik im Spiegel der Kulturgeschichte 2 |
|
Das Verhältnis Mensch-Pflanze: Ein zerbrochener Spiegel? In verschiedenen Schüben, begünstigt zunächst durch die wachsende Bedeutung von Viehzucht und Tieren, dann durch Technisierung, monotheistische Religionen usf. hat sich die Akzeptanz von Pflanzen als Kommunikationspartner und - medium in Europa drastisch verringert. Kulturhistoriker beschreiben diese Zurückdrängung als Zivilisation, Entmystifizierung, Säkularisierung, Aufklärung u.ä. Den letzten nachhaltigsten Anstoß zur Ausgrenzung von Pflanzen erleben wir seit der frühen Neuzeit. Während die Christen bis zur Glaubensspaltung Pflanzen als ein Medium göttlicher Verkündigung allgemein akzeptierten, hat der Protestantismus mit seiner strikten Reduktion der göttlichen Informationsmedien auf die Heilige Schrift (Sola scriptura) auch auf diesem Felde ein monomediales, ausschließlich auf den Menschen bezogenes Kommunikationskonzept durchgesetzt.4 Die Verzauberung der Technik Mit der sogenannten Entzauberung der Pflanzen und Tiere ging und geht gleichzeitig in den Industriegesellschaften Europas eine Verzauberung der Technik einher. Deutlich kann man dies z. B. an der Schlüsseltechnologie der Buchkultur, dem Buchdruck, zeigen. Sie wird mit einer atemberaubenden Geschwindigkeit vermenschlicht, ihr wird die Fähigkeit Wissen zu speichern und zu vermitteln, aufklärend zu wirken, Demokratie zu schaffen usf. schon seit den letzten Jahrzehnten des 15. Jahrhunderts zugeschrieben. Mit der Nutzung der elektronischen Datenverarbeitung in den 50er Jahren werden an den Maschinen nicht nur Ähnlichkeiten mit den psychischen Speicherleistungen sondern auch mit der menschlichen Gehirntätigkeit erkannt. Das 'Elektronengehirn' kann denken. Dieser Vergleich ging vielen allerdings zu weit und es sind in der Zwischenzeit eine Reihe von Beiträgen erschienen, die belegen wollen, "warum Computer nicht denken" können. Man kann demnach die Entwicklung wie folgt zusammenfassen: Der Ausgrenzung der Pflanzen als Kommunikationspartner und -medium entspricht auf der anderen Seite die Einbeziehung der Technik in die menschlichen Kommunikationssysteme und ihre zunehmende Sozialisierung und Psychologisierung. Dieses Verdrängungsverhältnis, daß also die kulturelle Bedeutung der technischen Medien und Kommunikatoren nur auf Kosten der anderen, pflanzlichen erreicht werden kann, hat letztlich zu der Frage geführt, ob wir eine gestörte Beziehung zu den Pflanzen haben. |
| |
| 1 Ähnliches
gilt auch für die Beziehung Mensch : Tier. Allerdings sind hier schon
in der 2. Hälfte des 19. Jhs. Wiederannäherungen zu beobachten,
vor allem ausgelöst durch Charles Robert Darwins |