| Schon vor mehr als vierzig Jahren haben Sozialpsychologen
die mit dieser Einstellung an die Analyse von Gruppen und Institutionen
herangingen, die folgenden drei Vernetzungstypen als Restriktionen des 'all-channel'
Netzes empirisch nachgewiesen. Gegenwärtig tauchen diese Typen auch
in den Handbüchern der technischen Informatik und der Nachrichtentechnik
auf. |
| |
| |
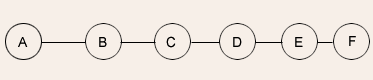 Abb.
2: Kettenförmiges Netz Abb.
2: Kettenförmiges Netz |
|
|
| |
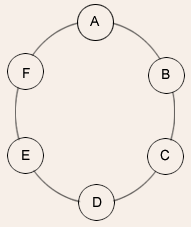 Abb.
3: Kreisförmiges Netz Abb.
3: Kreisförmiges Netz |
|
|
| |
| |
|
Abb. 4: Stern- oder baumförmiges
hierarchisches oder zentralisiertes Netz |
| |
| Praktisch sind diese verschiedenen Vernetzungsformen in
einigermaßen komplexen Kommunikationssystemen immer miteinander verbunden
(vgl. etwa die Abbildung 5). |
|
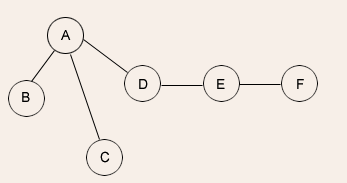 Abb.
5: Kombinierte Vernetzungstypen Abb.
5: Kombinierte Vernetzungstypen |
|
| |
| Die Vernetzungstypen bestimmen die Zugangsmöglichkeiten,
die der/die Einzelne zu den Informationen hat, die in dem Sozialsystem zirkulieren
und dessen Bestand garantieren. Ähnlich wie die Schaltpläne auf
den Chips geben sie Auskunft über die Leistungsmöglichkeiten ihrer
Elemente. Aufgrund der Flexibilität sozialer Systeme könnten sich
die Vernetzungsformen in ihnen theoretisch je nach den gerade anstehenden
Aufgaben ändern. Praktisch tendieren alle Kulturen, Institutionen und
Gruppen aber dazu, einmal etablierte Vernetzungsformen lange Zeit auch dann
beizubehalten, wenn etwa neue Aufgaben andere Netzeigenschaften erforderten.
Solche dysfunktionalen Erstarrungen aufzubrechen, ist ein Bemühen der
kommunikativen Organisationsentwicklung. |
| |
 |
Prämierung sprachlicher, schriftlicher oder anderer
technisierter symbolischer Informationsverarbeitung geringe Berücksichtigung der Multimedialität und von non-verbalen
Formen der Kommunikation.
geringe Berücksichtigung der Multimedialität und von non-verbalen
Formen der Kommunikation. |
 |
Starre Fixierung der verschiedenen Instanzen/Aufgaben der
sozialen Informationsverarbeitung  strikte Trennung von Sensor, Effektor, Speicher, Reflektor etc..
strikte Trennung von Sensor, Effektor, Speicher, Reflektor etc.. |
 |
Formal festgelegte Einschränkung der theoretisch möglichen
Kommunikationskanäle der sozialen Gruppe  soziale Verkabelung, Verlust flexibler Kopplungen.
soziale Verkabelung, Verlust flexibler Kopplungen.
(Vgl. die Kritik der Soziometrie, Kapitel 10) |
 |
Die Möglichkeit des Feedback (der unmittelbaren Interaktion)
wird eingeschränkt, was den Aufwand an Planung, Voraussicht etc. vergrößert,
die Trennung von ausführender, planender, und kontrollierender Tätigkeit
fördert. Die Selbststeuerung wird der Fremdsteuerung untergeordnet. |
 |
Alles zusammengenommen führt das zu einer Vernetzung
in Form der hierarchischen Informationspyramide. Der Informationsfluss von
unten nach oben muss selektiv sein. An der Spitze kann unmöglich alles
verarbeitet werden, was unten anfällt. |
 |
Umgekehrt müssen die Informationen auf dem Weg von
oben nach unten beständig angereichert, konkretisiert werden. |
 |
Für das Informationsmanagement sind flache Hierarchien
günstiger als Pyramiden: |
| |
Werden soziale Systeme in dieser Weise abgebildet, spricht
man von Sozio-und Organogrammen bzw. von Soziomatrizen. Alle Soziogramme
lassen sich in Sozimatrizen überführen (und umgekehrt) und damit
den Verfahren der Matrizenrechnung zugänglich machen.
Im Prinzip kann der Forscher frei entscheiden, welche Form des Sozialkontakts
er beobachten und damit zum Katalysator der Systembildung machen will.
Bekannt wurden vor allem der Vorschlag von Jakob Levy Moreno (1890 - 1974),
die subjektiven Präferenzbeziehungen in Gruppen als Kriterium/Katalysator
zu nehmen: Die Mitglieder des Sozialsystems werden aufgefordert, andere
Gruppenmitglieder für gruppenrelevante Tätigkeiten auszuwählen
oder abzulehnen. Die Anzahl der Wahlen bestimmt den 'soziometrischen Status'
des einzelnen. Moreno hat dieses Verfahren 'Soziometrie' genannt. (Die Grundlagen
der Soziometrie, Köln 1954, zuerst Washington 1934). Er sah darin weniger
ein apartes wissenschaftliches als vielmehr ein gruppendynamisches Instrument:
"Der soziometrische Test in seiner dynamischen Form ist eine revolutionäre
Kategorie der Forschung. Er stürzt die Gruppen von innen her um"
- indem der ihr eine Bestandsaufnahme des eigenen Verhaltens vorlegt - "und
verändert ihre Beziehung zu anderen Gruppen; er stellt eine Sozialrevolution
kleineren Ausmaßes dar". (Sociometry and marxism. Sociometry
12, 1949: 104 - 143, hier 114). Moreno besitzt insoweit Verdienste für
die Gruppendynamik und die 'Aktionsforschung'. Seine Definitionen wurden
in der Folgezeit vielfach kritisiert und erweitert, bspw. lassen sich Substrukturen
auch indirekt, durch die Ermittlung ähnlichen Wahlverhaltens ermitteln.
Die Frage, wie dauerhaft Sympathiewahlen die Gruppenstrukturen beeinflussen,
ist umstritten. M. Koskenniemi (Soziale Gebilde und Prozesse in der Schulklasse,
Helsinki 1936) hat etwa festgestellt, dass solche Wahlen 'flüchtige'
Erscheinungen sind. Bei Wiederholungen von Wahlen an nachfolgenden Tagen,
trafen weniger als ein Viertel der Schüler wieder die gleichen Entscheidungen.
|
| |
Die einfachste Form, in kommunikationsanalytischer Sicht
Soziogramme und Soziomatrizen zu entwickeln, ist die Ermittlung kommunikativer
Bahnen und deren Benutzung.
In einer Fünfergruppe beobachtet man z. B. folgendes Gesprächsverhalten:
A spricht B an und erhält von ihm eine Antwort; sodann wendet sich
B an C. C spricht E an und erhält eine Rückmeldung. B wendet sich
dann an D und D an C. Schließlich fragt E B, ohne eine Antwort zu
bekommen. Dies Geschehen lässt sich in folgendem Soziogramm darstellen: |
| |
|
| |
| In Matrizenform geschrieben: |
| |
|
A |
B |
C |
D |
E |
A |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
B |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
C |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
D |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
E |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
| |
| |
| 3. Die Messung der formellen Eigenschaften: Der
Zentralitätsindex |
| |
Der 'Zentralitätsindex eines Teilnehmers',
1950 von Bavelas vorgeschlagen, ist das Verhältnis der Summe aller
in einem Netz von allen Teilnehmern bei der Kommunikation zu überwindenden
Distanzen zu der Summe der vom betreffenden Teilnehmer zu überwindenden
Distanzen.
Nehmen wir an, bei einem kettenförmigen Netz kommuniziert der Teilnehmer
A vermittelt über die Teilnehmer B und C mit dem Teilnehmer D. Die
Maßeinheit der Distanz ist die kürzeste Verbindung zwischen zwei
Teilnehmern (= 1). Die Distanz würde also in diesem Fall 3 betragen.
Man ermittelt auf diese Art und Weise die Distanzen aller Teilnehmer und
addiert sie. Den Zentralitätsindex eines Teilnehmers erhält man,
wenn man diese Summe durch das Zentralitätsmaß des betreffenden
Teilnehmers teilt. |
| |
| Man kann dann auch den Zentralitätsindex des Gesamtnetzes
bestimmen, indem man die Zentralitätsindizes aller Teilnehmer addiert.
Den größten Zentralitätsindex hat das sternförmige
Netz, den geringsten das kreisförmige. |
| |
| Die Form des Netzes bestimmt für jeden Teilnehmer
also den Zugänglichkeitsgrad der Information. In einer zentralisierten
Struktur haben die Ausführenden an der Basis der Pyramide keine Möglichkeit,
Informationen über die Tätigkeit der anderen zu erhalten, außer
wenn der Führer (der über alle Informationen verfügt) sie
ihnen zukommen läßt (was für ihn einen enormen Arbeitsaufwand
bedeutet). Es läßt sich nun für jeden Teilnehmer ein Zentralitätsmaß
angeben. Dazu addiert man für jeden einzelnen die Anzahl der nötigen
Zwischenstellen, um einen anderen zu erreichen; diese Zahl wird zum Nenner
eines Bruches, dessen Zähler die Gesamtzahl aller Zwischenstufen für
das ganze Netz ist. Der Quotient ist der Zentralitätsindex des Teilnehmers.
Berechnen wir einmal diesen Index für die Mitglieder A, B und D in
einer zentralistischen Struktur:(1) |
| |
| 4. Hypothesen über die sozialpsychologischen
Auswirkungen der verschiedenen Vernetzungstypen |
| |
Der "Typ des Netzes beeinflusst das Verhalten der
Mitglieder, vor allem was die Gewissenhaftigkeit, die allgemeine Aktivität,
die Zufriedenheit angeht; und im Hinblick auf die Gruppe determiniert der
Typ des Netzes die Rolle des Leiters ebenso wie die Organisation der Gruppe."
(Harold J. Leavitt: Managerial Psychology. Chicago 1964)
"Die peripheren
Individuen, die end-men (die Männer am Ende der Kette) gelangen nur
schwer zur Mitarbeit und besitzen nur geringe Gruppenmoral. Eine möglichst
'egalitäre' Kooperation geht auf Kosten der Zeit, lässt aber die
Moral der Gruppe steigen. In einem Satz: Zentralismus und Hierarchie in
einer Gruppe haben positive Auswirkungen auf Ertrag und Effektivität
einer Gruppe bis zu einem bestimmten Punkt, der tiefer liegt, als man gemeinhin
annimmt. Wird diese Grenze überschritten, steigt die Unzufriedenheit
der 'Basis', während die Masse der Arbeit den Chefs über den Kopf
wächst."
(Roger Mucchielli: Kommunikation und Kommunikationsnetze. Salzburg 1974:
64) |
| |
"Der Teilnehmer mit dem höchsten Zentralitätsindex
wird automatisch zum Leader, zumindest wird seine spontane Leadership-Rolle
begünstigt. Auf der anderen Seite kann ein Teilnehmer mit schwachem
Zentralitätsindex praktisch nicht Leader sein. Die Gruppenmoral (ausgenommen
die der bewussten Führungspersönlichkeit, wenn es eine gibt) ist
umgekehrt proportional zum Zentralitätsindex des Netzes." (Mucchielli
1974: 62)
Nach dem gleichen Muster lassen sich auch noch eine Reihe von weiteren Indizes
ermitteln. Der sogenannte 'Verknüpfungsindex' beispielsweise ist die
Zahl von Kanälen, deren Schließung die Isolation oder die Desintegration
eines Teilnehmers bewirkt. Bei kettenförmigen Netzen beispielsweise
reicht es, einen einzigen Kanal zu schließen, um einen Teilnehmer
zu isolieren. Der Verknüpfungsindex beträgt also hier unabhängig
von der Teilnehmerzahl immer 1. In einem kreisförmigen Netz beträgt
er demgegenüber 2. Am schwierigsten ist die Isolierung selbstverständlich
in einem 'all-channel-Netz', wo es 'n-1' Kanäle (wobei n die Anzahl
der Teilnehmer ist) bedarf, um irgendeinen Teilnehmer zu isolieren.
Je geringer der Verknüpfungsindex ist, umso leichter zerfallen die
entsprechenden Sozialsysteme.
Leavitt hat dann noch den Index der 'relativen Peripherität'
eines Mitglieds eingeführt: Er berechnet sich aus der Differenz zwischen
dem Zentralitätsindex des betrachtenden Teilnehmers und dem Zentralitätsindex
des zentralen Teilnehmers des Netzes. Diese Differenz ist in einem all-channel-Netz
immer null (weil alle Teilnehmer gleichmäßig vernetzt sind);
er steigt mit jeder Verzweigung.
Der Peripheritätsindex ist also umgekehrt proportional zur gleichberechtigten
Teilnahme der einzelnen Mitglieder des Netzes an Informationen und Entscheidungen. |
| |
| *Auswirkungen des Zentralitätsindex auf Arbeit
und Moral der Gruppe: die "Zentralität" beeinflusst
das Verhalten: jemand, der leichten Zugang zu Informationen hat und sie
verwerten kann, befindet sich in einer psychologisch und materiell verschiedenen
Situation von einem, dem dieser Zugang verwehrt ist. |
Daher erzeugt die Stellung des Bestinformierten in diesem:
 größere
Unabhängigkeit, größere
Unabhängigkeit,
 größeres Verantwortungsbewusstsein,
größeres Verantwortungsbewusstsein,
 größere Befriedigung;
größere Befriedigung; |
| umgekehrt fühlt sich das "Ende der Kette"
unterdrückt, unverantwortlich und unbefriedigt. |
| Das Zentralitätsmaß einer bestimmten Stellung
hat Konsequenzen im Bereiche der Arbeit: |
 Beschleunigung bei der Zentralperson - Verlangsamung an der Basis,
Beschleunigung bei der Zentralperson - Verlangsamung an der Basis, |
 geringere Irrtumswahrscheinlichkeit - größere Irrtumswahrscheinlichkeit,
geringere Irrtumswahrscheinlichkeit - größere Irrtumswahrscheinlichkeit, |
 Initiative - Bequemlichkeit,
Initiative - Bequemlichkeit, |
 Dynamik - Verbitterung, Aggression.
Dynamik - Verbitterung, Aggression. |
| So sind Verhaltensweisen, persönliche Reaktionen,
Moral, Befriedigung durch die Arbeit und Ausmaß der Zufriedenheit
mit der Gruppe Funktionen des Netzes und der Bedingungen, die es schafft. |
| |
| |
Zurück zur 
|
|
|



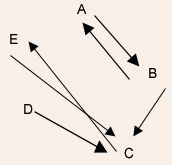
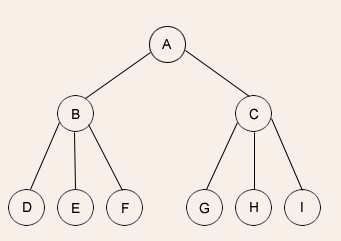 Sogenanntes
„zentralisiertes“ Netz
Sogenanntes
„zentralisiertes“ Netz