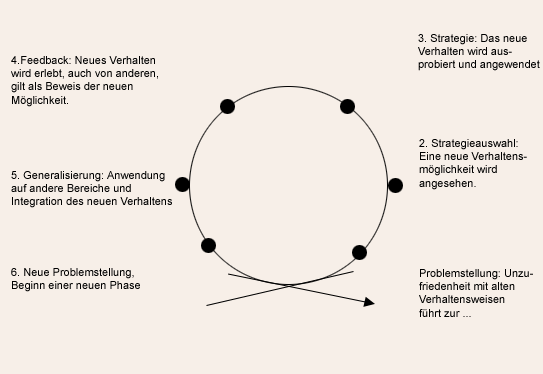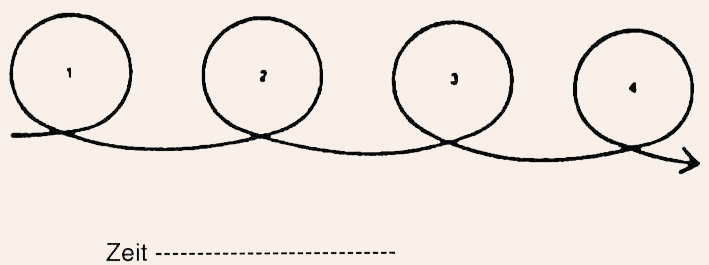| |
| I.A Wellenbewegung |
| Wellenbewegungen können wir in allen Gruppen ausmachen.
Auf eine intensive Arbeitsphase folgt Ruhe, Unlust. Lernfreude löst
Desinteresse ab. Selbsterfahrungsgruppen versacken nicht selten nach einer
intensiven, alle befriedigenden Sitzung beim nächsten Mal in irgend
einem Loch – während die schon totgeglaubte Projektgruppe wie
aus heiterem Himmel plötzlich doch noch arbeitsfähig und produktiv
wird. Das Auf und Ab wird von Sättigung und Neugier bestimmt. Wenn
man lange genug über einen Konflikt gesprochen hat, dann hat man langsam
die Nase voll davon und versucht die Situation (auf) zu lösen. Ein
lange vernachlässigtes Thema gewinnt allein deshalb an Reiz, weil es
wieder wie neu klingt. Es meldet sich von selbst und verhindert „Entwicklungslücken“.
Das gilt selbst für gesamtgesellschaftliche Prozesse. Das heiß
umstrittene Autoritätsthema der 68er Jahre lockt heute niemanden mehr
hinter dem Ofen hervor; für Bio-Kost, Spiritualismus hatte damals kaum
jemand etwas übrig. |
| Wasserwellen können langlaufend oder steil, rasch
oder gemächlich aufeinanderfolgen, sanft rollen oder in sich selbst
stürzen – das gilt auch für Gruppenprozesse. Noch eine weitere
Parallele hat Gültigkeit: Man erreicht sein Ziel als Schwimmer leichter
oder überhaupt, indem man sich den Wellen überlässt bzw.
behutsame Richtungsänderungen versucht. Ein Gruppenleiter, der sich
dem wellenförmigen Energiefluss seiner Gruppe entgegenstemmt, ist schlecht
beraten, steht evtl. auf verlorenem Posten. Er verbraucht dadurch viel zu
viel eigene Energie und verzehrt und blockiert die der anderen – die
ihn, wenn er sie stört, bei Seite räumen können. |
| Bei der Analogie zum Wasser gibt es allerdings eine wichtige
Einschränkung. Gruppenmitglieder und –leiter können –
wenn sie den eigenen Energiefluss, Gruppenprozess beobachten, registrieren
und die Gründe dafür erkunden – diesen Prozess selbst beeinflussen
und steuern. Eine Gruppe, die ihrer eigenen Lustlosigkeit auf die Schliche
kommt, kann diese eher überwinden, als die, die Sie auslebt. Bzw. ihr
unterworfen bleibt. Das gilt für Gruppen so, wie für Individuen:
Wenn ich meine Angst verspüre, akzeptiere, dass sie da ist, ergründe,
was mich ängstigt und all dies als gegeben hinnehme – dann hat
die Angst ihr Ziel erreicht: Sie hat mir „klargemacht“, was
mich ängstigt, sie hat ihre Warnfunktion erfüllt und kann dann
abklingen, verschwinden. |
| Mit dem Grundmuster der Wellenbewegung können wir
gut die Energieverlaufskurve einer Gruppe erfassen. Es eignet sich auch
dort, wo die Gruppe immer wieder ähnliche Inhalte zu bearbeiten hat. |
| |
| 1. |
Prozessmodelle sind Sehhilfen. Sie beschreiben Abläufe
in Gruppen, die uns ohne eine solche Systematik entgehen. Ohne sie, drohen
wir in der Fülle der Ereignisse unterzugehen oder falsche Schlüsse
aus unseren Beobachtungen zu ziehen. |
| 2. |
Sie sind idealtypisch. „Eigentlich“ sollte
eine Gruppe sich so entwickeln, verhalten, entfalten, wie beschrieben. Natürlich
ist es in der Praxis anders. Wenn die Ängste der Anfangsphase übersprungen
werden und die Gruppe einen Blitzstart hinlegt, müssen Aspekte der
Anfangssituation spätestens dann nachgeholt und bearbeitet werden,
wenn dem ersten die Luft ausgeht, und man sich auf ein anderes Tempo einigen
muss. Gerade in diesen Fällen entfalten Gruppenmodelle für den
Gruppenleiter ihre positive Funktion: Sagen sie uns doch, dass diese Gruppe
wohl zu schnell war, dass sie einen Rückfall haben wird, dass wir gut
daran tun, das als Merkposten festzuhalten. Der Einbruch, die Krise trifft
uns dann eben nicht aus heiterem Himmel, sondern aus einem immer schon leicht
bewölkten, und wir können besser reagieren. |
| 3. |
Die Modelle betonen unterschiedliche Aspekte des Gruppengeschehens.
Wenn eines deshalb nicht so recht zu passen scheint, sollte man nicht solange
an der Gruppe drehen, bis sie zum Modell passt, sondern prüfen, ob
ein anders die vorgefundene Realität nicht besser erfasst. |
| 4. |
Gruppen entwickeln sich nicht kontinuierlich, sondern „dynamisch“.
Es gibt Blitzstart, Spätentwicklung, Blockaden, Marotten, die sich
plötzlich als kreative Lösungsansätze entpuppen. Das gibt
dem Gruppenleiter – vor allem als Neuling – manche harte Nuss
zu knacken. Es durchkreuzt auch unsere Neigung, uns durch genaue Planung
abzusichern. Die erforderliche Grobplanung muss immer wieder korrigiert
und durch Feinplanung ersetzt werden. Positiv ist daran, dass es in Gruppen
nicht langweilig wird, wenn wir sie in ihrer Eigenentwicklung unterstützen. |
| 5. |
Gruppenprozesse setzen sich aus vielen kleineren Einzelereignissen
zusammen. Eine Gruppe kann z. B. ihre Arbeitsfähigkeit dadurch erreichen,
dass sie mit Erfolg eine Aufgabe bewältigt, dass sie sich darüber
verständigt, wie sie Aufgaben angehen will, oder dass sie aus einem
früheren Misserfolg ihre Konsequenzen zieht. Aus diesen oder weiteren
Situationen kann die Gruppe Informationen gewinnen, wie sie am besten ihre
Aufgaben bewältigen kann. Die Gruppe kann mithin ihr Ziel auf unterschiedlichen
Wegen erreichen. Für den Gruppenleiter aber auch für die Mitglieder
bedeutet dies zweierlei: Sie können durch ihre Beiträge und Interventionen
den Gruppenprozess beschleunigen oder behindern. Im Fall der Beschleunigung
verfestigen sie die einmal eingeschlagene Richtung. Im anderen Fall behindern
sie. Das bedeutet aber keineswegs, dass die weitere Entwicklung ein für
allemal verbau ist. Die Gruppe kann, wenn sie es nur will, ihr Ziel auf
unterschiedliche Wege erreichen. |
| |
|
| II.B Der Gruppenprozess als Verhaltensänderung |
| Kurt Lewin, der Begründer der Gruppendynamik, beschrieb
den Prozess der Veränderung von Gruppen mit den Begriffen: unfreezing,
change, refreezing; auftauen-ändern-festigen. Das klingt so plausibel
wie trivial. Im konkreten Gruppengeschehen erweist sich die Selbstverständlichkeit
aber immer wieder als Problem. |
| |
| 1. Auftauen |
| Auftauen meint die Bereitschaft sich/etwas zu verändern.
Im Falle von Wissenserwerb genügt die vorhandene Neugier; fehlt sie,
kann die Motivationsphase das Interesse für den Gegenstand wecken.
Je mehr nun das Erlernte mit unseren Gewohnheiten, Überzeugungen, Grundhaltungen
zu tun hat, um so diffiziler wird es. „Natürlich will ich mich
verändern“ – dieser Satz geht vielen glatt und flott von
den Lippen. Aber wenn es ernst wird, melden sich Widerstände, Beharrungsvermögen
und Zweifel: Wer sagt mir denn, ob es wirklich nötig ist, mir nutzt,
gut tut? In der Psychotherapie gibt es dazu ein Bonmot: Der Entschluss,
eine Therapie zu beginnen, ist der letzte Versuch, sich nicht zu ändern.
Mit dem Eingeständnis, Therapie zu brauchen, meint man genug getan
zu haben. Auftauen kann also einmal bedeuten, die Ängste, die Widerstände
zu bearbeiten, die die Änderung blockieren. |
| Zum Auftauen gehört auch die Einsicht, dass die alten
Verhaltensmuster unangemessen sind. Mehr noch, dass sich so etwas wie Leidensdruck
mit den alten Zuständen einstellt. Eine Lerngruppe muss den Wissens-,
Kenntnismangel ein- und zugestehen. Das tut man nicht gern. Denn dann ist
man je unfertig, unperfekt, dem Dozenten und anderen unterlegen. |
| Auftauen ist also mit viel Unsicherheit verbunden. Die
alte Sicherheit geht dahin, die neue ist allenfalls als Versprechung in
Sicht. |
| Beim Erlernen neuer Techniken (etwa Netzplantechnik) ist
das Unbehagen vielleicht am besten mit der generellen diffusen schullernbezogenen
Fragen „ob ich es wohl schaffe“ zu umschreiben. Eine Trainingsgruppe,
ein Arbeitsteam, die ihre Konflikte bereden wollen, mobilisiert tiefergehende
Ängste: Werde ich als Person überhaupt bestehen? |
| Es ist deshalb nicht verwunderlich, wenn Teilnehmer das
Auftauen schnell hinter sich bringen wollen. Dem muss der Leiter entgegentreten
und die Ausgangslage abklären. Dabei kommt es natürlich einmal
mehr nicht auf Vollständigkeit an, sondern auf optimale Offenheit.
Was muss hier und heute besprochen werden, was später. Lässt der
Leiter sich von einer Gruppe einwickeln, treibt ihn die Angst zum nächsten
Schritt, so hat er bald ein doppeltes Problem. Es bewegt sich nicht. Die
Teilnehmer sind enttäuscht, dass sich nichts tut. Dem Leiter werfen
sie Erfolglosigkeit vor. Spätestens hier muss man dann das Auftauen
nachholen. Das wird schwieriger. Unterbleibt das Auftauen zu Beginn, dann
gewinnt das leicht das leicht den Charakter eines Versprechens: Die Ziele
sind auch ohne Wirkliche Veränderung, ohne mehr oder minder tiefgehende
Verunsicherung erreichbar. Manche sind dann enttäuscht, weil der Leiter
sie über die tatsächliche Situation im Unklaren ließ, andere
kehren nun den Spieß um. Sie machen den Leiter zum Sündenbock.
Er ist schuld, dass sich die Teilnehmer ändern müssen, er verursacht
ihrer Änderungsängste. |
| |
| 1. Problemstellung |
| Die Gruppe stößt auf ein Problem, für das
keine abrufbare Lösung existiert. Dabei kann es sich um inhaltliche
Schwierigkeiten handeln oder um Unzufriedenheit mit eigenem oder fremden
Verhalten. Durch die Situation entsteht ein Verhaltensvakuum, dass zunächst
einmal erkannt und dann als Problem anerkannt werden muss, das eine Bearbeitung
erfordert. Dabei muss die Gruppe gegen die Neigung ankämpfen, die neue
Situation mit anderen, bereitliegenden, gekonnten Lösungsschritten
zukleistern zu wollen. Das Mehr von – Selben – ist der Grund
dafür, dass viele Gruppen Problempflege statt Problemlösung betreiben;
weil die Situationsdiagnose unterblieb, fehlt die Voraussetzung zur Weiterentwicklung. |
| 2. Strategieauswahl |
| Wenn die Gruppe darüber Konsens erreicht, dass es
ein ungelöst, aber zu lösendes Problem gibt, ist der erste wichtige
Schritt getan. Jetzt ist die Kreativität der Grünlichtphase des
brainstormings angesagt. Ideen sollten produziert werden, ohne sie gleich
auf Durchführbarkeit zu überprüfen (Im Arbeitspapier „Erleichterung
und Behinderung des Informationsaustauschs in Gruppen“ finden Sie
dazu methodische Hinweise). Aus der Vielzahl der Ideen ist dann die optimale
Vorgehensweise herauszufiltern. Im Glücksfall ergibt sich das aus der
Logik der Sache. Schwieriger ist es, wenn hier die Gruppendynamik zuschlägt
– also Interessen, Vorlieben, die Machtstruktur. Mit Hilfe von Einzelbewertung
der aufgelisteten Punkte kann man noch die relativ unbeeinflusste Gruppenmeinung
erfassen. Gelingt das nicht, dann muss man das Thema der unterschiedlichen
Interessen offen behandeln. Das erfordert viel Gespür, Geschick, methodische
Kenntnisse und Beharrungsvermögen. Die Gruppe kann hier natürlich
auch falsch entscheiden. |
| 3. Strategieausübung |
| Die getroffene Entscheidung wird ausgeführt. Das kann
im Probelauf eines Rollenspiels geschehen oder aber direkt in der Realsituation. |
| 4. Feedback |
| Es gibt keine Garantie dafür, dass der eingeschlagene
Weg richtig ist. Das verleitet viele dazu, um so beharrlicher an ihm festzuhalten.
Bevor man sich erneut dem Unbehagen der Problemstellung aussetzt, macht
man lieber weiter wie bisher. Auch Zweifel, ob die anderen die einen bewegenden
Fragen überhaupt aufgreifen, Trägheit, verleiten zum Mehr-vom-Selben.
Gerade weil das so ist, ist die Feedbackphase so immens wichtig. Waren Strategiewahl
und Art der Ausführung richtig, oder wo müssen sie verändert,
angepasst werden? Dies sind die Fragen, mit denen die Gruppe ihre eigene
Leistung kontrolliert. |
| 5. Generalisierung |
| Hier wird im individuellen und Gruppengedächtnis festgehalten,
was man von der eingeschlagenen Lösung verwenden kann. Auch diese Phase
gehört notwendig zum Prozess der Problemlösung. Meist kommt es
nämlich zur Über- oder Untergeneralisierung. Es gilt für
alles, es gilt nur selten. Der unvermeidliche Reinfall bei der ersten Alternative
legt es dann später nahe, den Ansatz ganz zu verwerfen; fehlende Übung
bei der letzten – warum eine verworfene Alternative erneute ausprobieren
– sorgt für sanftes Vergessen. |
| |
| II.F Abwehr im Gruppenprozess |
| |
| Bion (1968), ein englischer Psychiater, hat
die Grundverhaltensweisen beschrieben, die in allen Gruppen
auftauchen. Er benennt drei kollektive Grundeinstellungen: |
 |
Kampf – Flucht; |
 |
Paarbildung; |
 |
Abhängigkeit. |
|
|
| |
| 1. Kampf – Flucht |
| Die Gruppe sucht sich – allerdings nicht als bewusste
Suche – einen gemeinsamen Feind (vornehmlich den Leiter, das Programm,
die konkrete Aufgabe). Dieser wird angegriffen oder vermieden – oder
beides zusammen. Es ist der Versuch, der realitätsgerechten Auseinandersetzung
mit der Aufgabe auszuweichen. |
| 2. Paarbildung |
| Man schließt sich an einen anderen an, um der Verlorenheit
in der Gruppe zu entfliehen. Die Paar, aber auch die anderen neigen dazu,
die Paarbildung zu idealisieren. Man ist überrascht, wie gut man zueinander
passt und tut alles dagegen, das genauer unter die Lupe zu nehmen. Man befürchtet
nämlich zurecht, enttäuscht zu werden. Es ging nämlich nicht
um den konkreten anderen, sondern um den anderen als Abwehrmöglichkeit
gegen die als bedrohlich empfundene Gruppe und das Alleinsein in der Gruppe. |
| Die Gruppe widersetzt sich ebenfalls der Entzauberung der
Paare allerdings aus einem anderen Grund. Die oft getrennt geschlechtlichen
Paare beleben nämlich alte Phantasien, die sich an die lebensspende
Funktion von Eltern heften. Geboren werden, alles noch einmal neu und anders
machen könne, Phantasien um Erlösung lauten die (Heils)-erwartungen.
Solange die Paare bestehen, können diese Träumen aufrechterhalten
bleiben. |
| 3. Abhängigkeit |
| Die Gruppe erwartet Orientierung und Hilfe vom Leiter.
Ihre Kritikfähigkeit ihm gegenüber ist erheblich vermindert. Eigene
Autonomie und Selbständigkeit werden verleugnet. |
| Bion hat in seinen drei Phasen in Gruppen immer wieder
beobachtbare Abwehrmechanismen beschrieben. Bearbeitbar werden sie dadurch,
dass sie angesprochen werden bzw. dadurch, dass die Gruppe durch erfolgreiche
Arbeitsbewältigung an Sicherheit dazugewinnt. |
| Ihre Kenntnis kann dem wenig bzw. gar nicht psychoanalytisch
Geschulten hilfreich sein, sonst schwer verständliche Reaktionsweisen
einzuordnen. Allerdings bleibt das immer eine heikle Gradwanderung. So kann
man Abhängigkeit der Gruppe als freiwillige Unterordnung unter eine
anerkannte Autorität ebenso missdeuten, wie berechtigte Kritik am Leiter
als Kampf-Flucht. Das schränkt die Verwendbarkeit des Modells für
den Laien erheblich ein. |
| |
| |
| II.G. Autorität und Intimität im Gruppenprozess |
| Autorität und Intimität sind zwei wichtige Dimensionen
einer jeden Gruppe. Wer hat die Macht und wie nah bzw. fern sind sich die
Gruppenmitglieder? |
| |
| Bennis und Shephardt (1956) untergliedern folgendermaßen: |
| DEPENDENZ |
| 1. Abhängigkeit – Flucht |
| Die Anfangsphase jeder Gruppe ist durch Unsicherheit und
Angst bestimmt. Explizit oder implizit erwarten die Teilnehmer, dass der
Leiter diese verringert. Zur Bewältigung der Anfangssituation greifen
sie auf Verhaltensweisen zurück, die sich im Umgang mit Autoritäten
bewährten. Man wendet sich Informationen, Aufklärung und Orientierung
suchend an den Leiter und erhofft von ihm Lösungen. Die Gruppenmitglieder
sind, bzw. fühlen sich vom Leiter abhängig und fliehen davor zurück,
diese Abhängigkeit aufzudecken. |
| 2. Gegenabhängigkeit – Kampf |
| Der Leiter kann – selbst wenn er es wollte –
nicht die an ihn gerichteten Erwartungen erfüllen. Es sind zu viele
und sie widersprechen sich. Die Enttäuschung der Gruppenmitglieder
mit dem unrealistisch überschätzten Leiter schlägt um. Er
wird für alle Übel, die der Gruppe wiederfahren verantwortlich
gemacht und deswegen angegriffen. Hat man vorher seinen Worten blindlings
Glauben geschenkt, so gelten sie nun gar nichts mehr. Befolgte man vorher
seine Hinweise, Ratschläge peinlich genau, so tut man nun gerade das
Gegenteil. |
| 3. Auflösung der Abhängigkeit |
| Gegenabhängigkeit und Kampf lösen die vorher
herrschende lähmende Abhängigkeit und Flucht ab. Je mehr dies
geschieht, um so mehr erkennen die Gruppenmitglieder ihre eigenen Fertigkeiten
und Fähigkeiten als Leiter. Der Leiter muss nicht länger überhöht,
aber auch nicht herabgesetzt, entwertet werden. Zunehmend zählt, was
jemand sagt, nicht bloß, wer es sagt. Führungsrollen wechseln
je nach Befähigung der Teilnehmer ab, der Leiter übernimmt bzw.
behält seine Sonderrolle. |
| Diese Auseinandersetzungen können wir in allen Gruppen
beobachten. Sie vollzieht sich manchmal dramatisch, oft auch fließend
und wenig auffällig. Diese Entwicklung ist unterlässlich, soll
die Gruppe ihre Potenzen entfalten können. Als Gruppenleiter ist man
gut beraten, sich dem sog der Verherrlichung zu widersetzen. Die Funktion
ist gemeint, nicht die Person. In der Gegenabhängigkeit hilft diese
Perspektive manchen harten Angriff auszuhalten. |
| 4. Bezauberung – Flucht |
| Wenn die Machtfrage vorläufig geklärt ist, breiten
sich oft Ausgelassenheit und Fröhlichkeit aus. Die erste Probe ist
bestanden, weitere braucht man nicht. Die Gruppenmitglieder rücken
näher zusammen und verschanzen sich hinter einem Bollwerk von Solidarität
und Gleichheit. Die unterschiedlose dichte Nähe stiftet aber neue Abhängigkeit
– diesmal von der Sympathie und dem Wohlwollen aller. Der Preis dafür
ist zunehmende Handlungsunfähigkeit. |
| 5. Ernüchterung – Kampf |
| Handlungsunfähigkeit und Enge werden zunehmend als
Behinderung erfahren. Die Gruppenmitglieder protestieren gegen die Forderung,
bedingungslos in der Gruppe aufzugehen. Zwischen denen, die Intimität
befürworten und fordern und denen, die diese fürchten und ablehnen,
beginnen klärende Auseinandersetzungen. |
| 6. Realistische Einschätzung der Beziehung |
| Die Gruppe erkennt an, dass die Teilnehmer unterschiedliche
Nähebedürfnisse haben und dass es ein Fließgleichgewicht
zwischen Machtanspruch und Intimität geben muss, um sowohl arbeits-
als auch genussfähig sein zu können. Die Gruppe steuert diese
beiden Prozesse zunehmend selbständig. Die Sonderrolle des Leiters
bezüglich Autorität und Intimität wird zunehmend selbstverständlicher. |
| |
| Für den Leiter sind vor allem die Phasen 2 und 5 kritisch,
wenn ein Teil der Gruppe ihn unbarmherzig bekämpft bzw. gnadenlos vom
emotionalen Leben der Gruppe ausschließt. Dann rasch aufflammende
Ängste, Panik und Verzweifelung gehen um so eher vorüber, wenn
er diese Entwicklungsregelmäßigkeiten kennt und anerkennt. Er
hat dann gute Chancen, sich nicht selbst in den Auseinandersetzungen zu
verstricken und die Übersicht und damit seine Leiterfunktion zu verlieren. |
| |
| Diese Themen spielen in Gruppen sehr unterschiedliche Rollen.
Das hängt damit zusammen, ob die Rahmenbedingungen eine Auseinandersetzung
fordern, fördern oder unterbinden. In einem Training, einer Ausbildungsgruppe
kann man die Leiterautorität eher kritisch überprüfen, als
in einer Abteilungskonferenz mit großen Statusunterschieden. Im ersten
Fall ist die Auseinandersetzung oft offener, auch impulsiver, im anderen
oft verdeckter und verschleierter. Die klare Konfrontation ist vielen lieber
als die schwelende, diffuse Feindseligkeit. Erstere macht Entwicklung leichter
möglich. |
| |
| Eine Besonderheit unserer Tage ist die Vermischung der
beiden Hauptphasen. Viele Gruppen setzen die Intimität als Waffe in
der Abhängigkeitsthematik ein. Manche Gruppe entmachtet den Leiter
durch ein sanftes aber beharrliches Du. Die Nähe um jeden Preis wird
selbst dann aufrechterhalten, wenn darüber Effektivität und Arbeitsfähigkeit
verloren gehen. Fragen der Autorität und Intimität sind nie abschließend
zu lösen. Einmal mehr gilt das Spiralenmodell. Das Gleiche kehrt in
gewandelter Form wieder und erfordert eine neue Lösung. |
| |
| II.H Der Nutzen von Gruppenmodellen |
| Gruppenmodelle erlauben es, Gruppen differenziert und
vielschichtig wahrzunehmen und zu beschreiben. Das geht nicht von heute
auf morgen. Zunächst wird man sich damit begnügen müssen,
im nachhinein Etappen und Phasen zu identifizieren. Dabei begleitet die
Unsicherheit, ob das nun Abhängigkeit oder Gegenabhängigkeit
oder sonst etwas war. Hat man darin einige Übung, dann stellt man
plötzlich in einer laufenden Gruppe fest, dass einem etwas Vertrautes
auffällt. Man beginnt ablaufende Ereignisse als Stücke eines
Prozesses wahrzunehmen und zu verstehen. Wenn man Situationen richtig
versteht, steigt die Chance, richtig zu intervenieren. Es wird wahrscheinlicher,
dass man Gruppenentwicklungen unterstützt, vorantreibt, anstatt sie
zu behindern oder ihr Opfer zu werden. |
| |