| Die Epistemologie der KomSofo in Abgrenzung zur neuzeitlichen natur- und sozialwissenschaftlichen Erkenntnistheorie | |
Das Verständnis des Forschers und seiner
Beziehung zu den Untersuchungsgegenständen ist in der kommunikativen
Sozialforschung ein grundsätzlich anderes als in der empirischen
Sozialforschung und im traditionellen neuzeitlichen Wissensverständnis
überhaupt. |
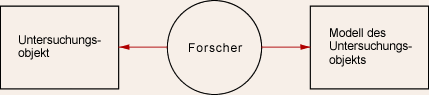 |
| Wahrnehmung-Analyse-Darstellung |
Natürlich haben Wissenschaftler immer
gewußt, daß sie ihre Untersuchungsobjekte beeinflussen und
von diesen vielfältig beeinflußt werden und daß ihre
Modelle nicht nur etwas über das Untersuchungsobjekt sondern auch
etwas über sie selbst und das Forschungssetting aussagen. Aber sie
haben an dem Ideal der Subjekt-Objekt-Trennung und der Objektivität
von Beschreibungen festgehalten. |
| Gestalte die Datenerhebung so,
daß möglichst wenig Wechselwirkungen zwischen dem Forscher und
seinen Untersuchungsgegenständen auftreten können! (Diesem Ideal kommt die Beobachtung hinter einer Einwegscheibe vielleicht am nächsten.) |
|
| Verändere die Beziehung
zwischen Dir und den Untersuchungsobjekten möglichst nicht: Halte die
gleiche Distanz! Nutze die gleichen Beobachtungskategorien! Tue so, als
ob während der Datenerhebung die Zeit still steht. (Dies gelingt nur, wenn die Datenerhebung als Momentaufnahme oder als Folge von Momentaufnahmen gestaltet ist, die Zeit also als stillstehend während des Wahrnehmungsvorganges behandelt wird.) |
|
| Versuche Dich als Forscher als
eine hochselektive rationale Wahrnehmungs- und Auswertungsmaschine zu verhalten,
die möglichst nach den ausbuchstabierten Wahrnehmungs- und Kodierungsrastern
funktioniert! (Andere Sinneserfahrungen, Affekte, Assoziationen etc. stehen im Widerspruch zur Forderung nach Rationalität, Überprüfbarkeit usf.) |
|
| Das Modell soll den Untersuchungsgegenstand (und nicht den Forscher) beschreiben. |
| Die Beschreibung soll |
| schriftsprachlich, in mathematischen Formeln und/oder graphisch erfolgen | |
| allgemein, d. h. möglichst | |
| an allen Orten | |
| zu allen Zeiten | |
| für alle Personen/Rezipienten |
| Dieses erkenntnistheoretische Ideal hat sich im Spätmittelalter
mit der Herausbildung visueller, hochgradig genormter Wahrnehmungs- und
graphischer Darstellungsformen gesellschaftlich etabliert. ('Perspektive')
Im Werk von Albrecht Dürer wird es erstmalig einfach und klar für
eine breite Öffentlichkeit als der "richtige Weg" zu wahrer
Erkenntnis beschrieben, - und dem Ideal handwerklicher Kunst gegenübergestellt. Zugleich liefert Dürer auch das Konzept mit, nach dem diese Wissensproduktion sozialisiert, vernetzt werden soll. Es ist ja typischerweise so, daß das eben beschriebene Erkenntnismodell vom einzelnen (ggf. mit Technik bewehrtem) Forscher ausgeht. Die Vergesellschaftung wissenschaftlicher Erkenntnis erfolgt in einen hart abgegrenzten zweiten Schritt nach dem folgendem Modell: |
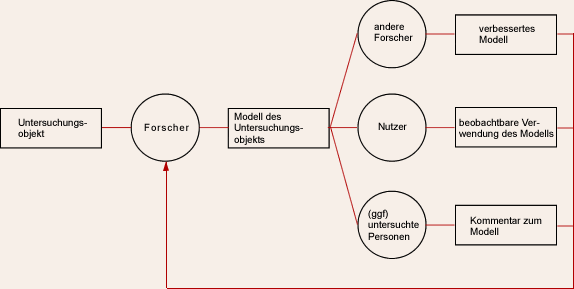 |
| Forschungsprozeß und -kommunikation (Rückkopplung) in der traditionellen (empirischen Sozial-) Forschung |
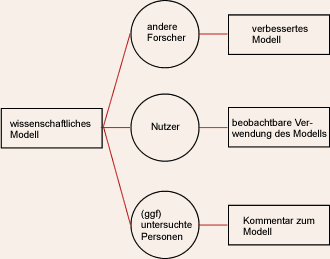 |
| Zusammenfassung Die Methodik und Methodologie der neuzeitlichen Natur- und Sozialwissenschaft entspricht den Anforderungen von Wissenproduktion und -verbreitung unter den Bedingungen interaktionsarmer Massenkommunikation. Das gedruckte Buch(1) ist der hauptsächliche Speicher und Transmissionsriemen. Die KomSofo orientiert sich daneben und schwerpunktmäßig am Dialog und leistet einen Beitrag zu einer Epistemologie interaktionsintensiver Kommunikation, wie sie auch für neue Vernetzungsformen wie dem Internet wichtig sind. Sie ist auch was die Datenauswertung und -speicherung angeht ohne die elektronischen Medien nicht denkbar. |
| (1) Giesecke, Michael; Von der typographischen zur elektronischen Konstituierung von Daten in den Sozial- und Sprachwissenschaften. In: Lili, Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik, H. 90/91, Jg.23, 1993: S.23-29 |