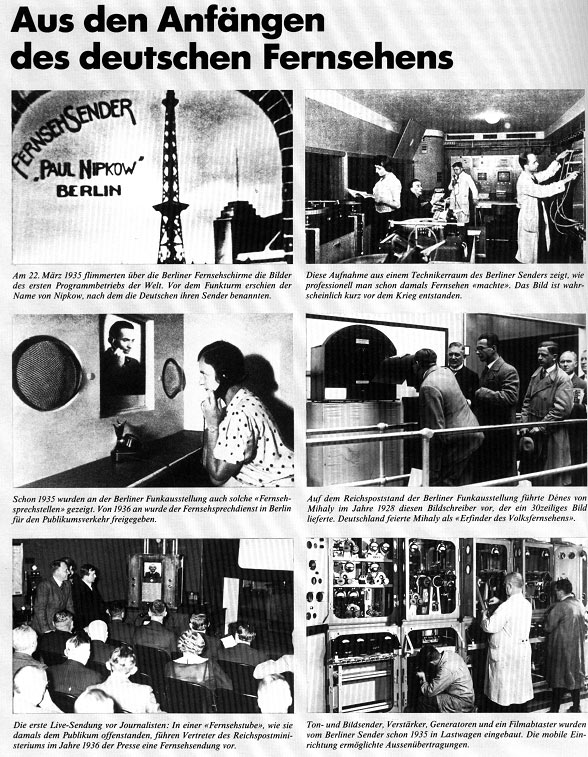Die mehrseitige Patentschrift Paul Nipkow (1860-1940),
mit der man die Geschichte des Fernsehens normalerweise beginnen lässt,
fängt mit folgendem Satz an:
"Der hier zu beschreibende Apparat hat den Zweck, ein am Orte A befindliches
Object an einem beliebigen anderen Orte B sichtbar zu machen." [7] Er
nannte seine Erfindung ,elektrisches Teleskop'. Teleskop bedeutet griechisch
so viel wie ‚Fern-Sehen' und diese Übersetzung hat sich nach 1890 auch
im deutschen Sprachraum allmählich entwickelt.
Seine technische Grundidee unterscheidet sich kaum von den wahrnehmungstheoretischen
Vorstellungen der Erfinder der Perspektive. Als er eine Kerze mit zusammengekniffenen
Augen ansah, war ihm aufgefallen, dass sich das Bild in einzelne Lichtpunkte
,zerlegte'. Mit seiner Erfindung wollte er Bilder in Lichtpunkte zerlegen
und diese dann wieder zusammensetzen. Heute würde man von einem pixelorientierten
Programm sprechen und könnte es von den vektororientierten perspektivischen
Projekten abgrenzen.
Er überlegte nun, wie man das Licht mit einer geeigneten technischen Vorrichtung
in einzelne Punkte zerlegen kann. Er fand die später nach ihm genannte
,Nipkow'-Scheibe, eine drehbare Metallscheibe mit 30 spiralförmig ausgestochenen
Löchern. Beim Drehen der Scheibe wandern diese Löcher von links nach rechts
(oder umgekehrt) und lassen jeweils nur bestimmte Lichtstrahlen, die von
den Objekten reflektiert werden, einfallen. Man kann auch sagen, die Objekte
werden Punkt für Punkt auf ihre Helligkeit hin ,abgetastet'. Das einfallende
Licht wird durch eine Linse auf eine Selenzelle gerichtet. Diese sind,
wie 1817 der schwedische Chemiker Jöns Jacob Berzelius erkannt hatte,
in der Lage, Licht in elektrische Energie umzuwandeln. Bei hellem Lichteinfall
erzeugen sie einen starken, bei weniger Licht einen schwachen Stromstoß.
Diese Stromstöße werden nun über Draht an einem Empfänger weitergegeben.
Das ist im großen und ganzen das Telegraphenprinzip. Der Empfänger besteht
aus einer Lampe, die je nach den Stromstößen mehr oder weniger viel Licht
abgibt, und aus einer zweiten Nipkow-Scheibe, die sich genau mit der gleichen
Geschwindigkeit wie die Aufnahmescheibe drehen muß. Das mehr oder weniger
helle Lampenlicht fällt nun durch die Löcher dieser Scheibe auf eine Projektionswand
und wenn sie sich rasch genug drehen, mindestens 10 Bilder pro Sekunde,
so entsteht auf dieser Projektionswand Zeile für Zeile das ursprüngliche
Bild. In der Theorie jedenfalls. Praktisch war es schwierig, die Scheiben
zu einem synchronen Lauf zu bringen, die Selenzellen arbeiteten zu ungenau
und so erwies sich letztlich der ,mechanische' Weg Nipkows als eine Sackgasse.
Das Prinzip des Auflösens des Bildes in Lichtpunkte, und zwar zeilenweise
und von oben nach unten, der Umsetzung der optischen Informationen in
elektronische Signale und des späteren, ebenfalls wieder zeilenweisen
Aufbaus des Bildes, aus den retransformierten Signalen blieb jedoch erhalten.
Es fällt auf, dass das Fern-Sehen nach dem Modell des Buchlesens, Buchstabe
für Buchstabe und Zeile für Zeile abläuft. Auch hier geht es wieder um
Zerlegen und Zusammensetzen von Informationen und um deren Transformation
von einem Medium in das andere. Um mehr nicht.
Der Nachteil Nipkows war, dass er diese Analyse und Synthese mechanisch
vornahm. Der spätere Nobelpreisträger Karl Ferdinand Braun (1850-1918)
erfand kurz vor der Jahrhundertwende die nach ihm später benannte Kathodenstrahlröhre
- die Braunsche Röhre. Damit konnte er die mechanische Analyse elektrifizieren.
Er bündelte einen Elektronenstrahl und lenkte ihn auf eine zu einem Bildschirm
aufgeblasene Glasröhre. Durch Ablenkplatten konnte der Strahl in alle
Richtungen beliebig auf dem Bildschirm bewegt werden. Beim Auftreffen
auf die Bildröhre wurden Lichtpunkte erzeugt. Wenn diese Lichtpunkte nun
sehr schnell nacheinander aufleuchteten, verarbeitet sie das Auge des
Betrachters als Umrißlinien oder auch als Bewegungen.
1906 gelingt Max Dieckmann, dem Assistenten von Braun, auf diese Weise
die elektronische ,Zeichnung' eines Bierkrugs. In den nächsten 20 bis
30 Jahren versuchten beinahe an allen Ecken der Erde zahlreiche Tüftler,
entweder mit dem mechanischem oder mit dem elektrischen System ,Fernsehaufnahmen'
zu erzeugen und zu übertragen. Die Qualität ist in diesen Anfangsjahren
nicht sonderlich gut und wie üblich wird das Ganze eher als eine Jahrmarktsbeschäftigung
und als ,Kuriosität' behandelt.
"Bezeichnend ist denn auch, wofür in Amerika das Fernsehen damals eingesetzt
wird: 1928 etwa wird eine ,Fernsehhochzeit' zelebriert, bei der Braut
und Bräutigam in verschiedenen Studios aufgenommen werden und sich über
einem Bildschirm das Jawort geben... ,,(Hadorn/Cortesi, S. 170). In Deutschland
werden im September 1928 Fernsehexperimente über den Berliner Sender Witzleben
ausgestrahlt - und zwar nach dem mechanischen Scanning-Prinzip von Nipkow.
Etwas später führt dann Manfred von Ardenne sein vollelektronisches Fernsehsystem
vor. 1935 schreibt er: "Der Augenblick ist gekommen, wo das Fernsehen
aus der Hand weniger Physiker und Techniker einem sich stetig vergrößernden
Kreise und schließlich der Allgemeinheit zugeführt werden muß". (Ebd.
S.173)
In Deutschland war dies der richtige Anstoß zur richtigen Zeit. Während
nämlich in Amerika und England die Rundfunk-, Presse- und Filmlobby wenig
Interesse besaß, in ein potentielles Konkurrenzunternehmen zu investieren,
fanden die Nationalsozialisten das neue Medium für ihre Zwecke interessant.
Auf je mehr Kanälen sie ihre Botschaft unters Volk brachten, auf je größere
Resonanz meinten sie hoffen zu können. Und wohl auch aus diesem Grund
bestanden sie darauf, dass das Fernsehen von Anfang an in ,Bild und Ton'
sendet. Merkwürdigerweise hatte man sich bei den früheren Fernsehversuchen
nur auf die Bildübertragung beschränkt. Am 22.3.1935 beginnt das Fernsehprogramm
mit Bildern über Großkundgebungen und von Adolf Hitler: "Nun ist die Stunde
gekommen, in der wir beginnen wollen, mit dem nationalsozialistischen
Fernsehrundfunk ihr Bild, mein Führer, tief und unverlöschlich in alle
deutschen Herzen zu pflanzen." Das neue Medium hatte eine eindeutige soziale
Aufgabe gefunden.
Von nun an wurde von Berlin regelmäßig dreimal in der Woche, zwischen
20.30 Uhr und 22.00 Uhr, das Programm ausgestrahlt. Empfangen wurde zumeist
in den sogenannten ,Fernsehstuben', die vorwiegend in Postämtern aufgestellt
waren und 30 bis 40 Zuschauerplätze hatten. |
Die Aufnahmesituation muss damals für alle Beteiligten
eine wahre Tortur gewesen sein: zunächst völlige Dunkelheit, dann ,Abtasten'
der Objekte im Scheinwerferlicht. Was aber wichtiger ist, die ,Persönlichkeit'
der ,Aufgenommenen' mußte entsprechend der technischen Möglichkeiten des
neuen Medium verwandelt werden. (Die Lippen der Ansagerinnen wurden schwarz
geschminkt, weil die Fotozellen der damaligen Kameras die rote Farbe nicht
gut ‚abtasten' konnten.) Die Augenlider erhielten einen grünen Aufstrich,
das Haar wurde mit Goldstaub überpudert. "Wenn die Ansagerin in einer
weißen Bluse im Studio erschien, wurde diese mit grauer Farbe überstrichen".
(Hadorn/Cortesi S. 174 f.)
Die Aufnahmetechnik war so aufwendig, dass man sich wirklich wundern kann,
dass schon am 30.4.1935 - in einer Generalprobe für die 1. Mai-Feier -
die erste Direkt sendung ,live' aus einem Berliner Lokal übertragen wurde.
Die Olympischen Spiele 1936 bildeten den ersten Höhepunkt der Fernsehgeschichte.
In 27 Fernsehstuben verfolgten insgesamt rund 150 000 Zuschauer die Sportübertragungen.
Die deutsche Fernsehindustrie machte mit dem Verkauf von Fernsehempfängern
einen riesen Umsatz.
Diese Entwicklung ist bekanntlich in Deutschland durch den Zweiten Weltkrieg
jäh unterbrochen (auch in England wird 1939 der Sendebetrieb eingestellt).
Währenddessen breitet sich das Fernsehen in den USA, wo es am 30.4.1939
den Programmbetrieb aufnahm, kontinuierlich aus. "Schon 1953 sind 20 Millionen
Geräte in Betrieb" (Ebd. S.180) und sie werden immer billiger.
Wie auch bei der Einführung der anderen technischen Medien, befürchtet
man ebenso beim Fernsehen ,gesundheitsschädigende Auswirkungen'. Das Image
des Fernsehens bleibt in Deutschland lange Zeit schlecht, schlechter jedenfalls
als jenes des etablierten Rundfunks. In der Konkurrenz zu diesem Medium
hat das Fernsehen auch einen schweren Stand. Das sieht man auch an der
Bezahlung. So plaudert Hans-Joachim Kulenkampff: ,,Wissen Sie, was ich
für eine Fernsehsendung gekriegt habe? Für zwei Stunden ,Wer gegen Wen'
zweihundert Mark; für dieselbe Sendung im Rundfunk habe ich siebenhundertfünfzig
Mark gekriegt. Erst Anfang der 60-er Jahre habe ich für eine Fernsehsendung
so viel gekriegt, wie für eine Rundfunk- sendung." (Agenda 2, 1992, S.
18)
Weitere Entwicklung: |