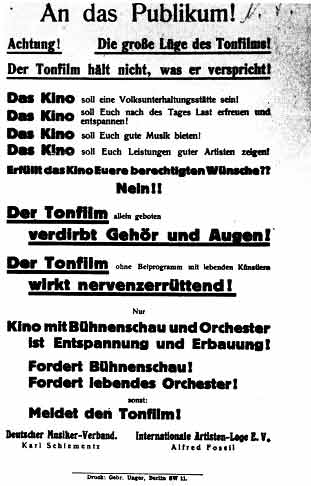Der Stummfilm verkoppelte sich schon sehr früh mit Musik
und die Zwischentitel steigerten den multimedialen Anspruch des Kinoerlebnisses
um eine Weiteres. Die Musik sprach durch Rhythmus und Melodie überwiegend
die Emotionen an und suggerierte die Stimmung, wobei die Zwischentitel für
die möglichst eindeutige Entfaltung der Fabel sorgten. Weitere beachtliche
multimediale Dürchbrüche verbuchte der Stummfilm - als Konkurrenzmedium
des Theaters - auch im Bereich der Gestik und Mimik, also der Schauspielkunst.
Die pantomimyschen Ausdrucksformen mussten einen Grossteil des Verbalen
ersetzten, besonders noch die sublimsten Nuancen menschlicher Kommunikation
- ein wesendlicher Beitrag zur allgemeinen körperlichen Emanzipation der
Zeit.
Was die massenweise Rezeption im Kino anbelangt, erfuhren die synästhetischen
Potenziale des neuen Mediums durch den Aufstieg des Tonfilms in den späten
20-er Jahren wohl die entscheidende Blockade. Der Hollywood Film erschien
‚wahrheitsgetreuer', Geschichten konnten (wieder) linear, stringent erzählt
werden. Der Anspruch auf simultane Wahrnehmung verlagerte sich auf filmische
Avantgarden (Expressionismus, Neue Sachlichkeit, Konstruktivismus). Vertreten
überwiegend durch formalistisch-politische künstlerische Bestrebungen und
aus der Öffentlichkeit zum ‚Experiment' gebannt, bekam die filmische Innovation
stärkeren Aufschub erst mit dem Autorenfilm und unabhängigen Produktionen
der späten 60-er und 70-er Jahre. Als die amerikanische Stummfilmindustrie
1927 ihren Höhepunkt bereits überschritten hatte, erkannte man, dass die
sinkenden Zuschauerzahlen nur mit dem Tonfilm, der schon seit 1924/25 ausgereift
war, entgegenzutreten waren. Interessanterweise wurde vor allem in Europa,
aber auch in den USA der Tonfilm anfangs nur zurückhaltend begrüßt: |