| Konstruktivität des Films | |
| Durch die gesteigerte Geschwindigkeit, Flüchtigkeit und Fragmentierung als Merkmalen des damaligen ästhetischen und gesellschaftlichen Moments - das alles infolge seiner technischen Beschaffenheit - nahm der Film organisch eine zunehmend konstruktiv(istisch)e Entwicklung. Die veränderte Raum- und Zeit-Wahrnehmung und der fiktive Charakter des Spielfilms erzwangen komplexe Balancemechanismen an der Seite der industriellen Produktion, z. B. die streng vorkonstruierten Akten wie Casting, Aufteilung in Drehtage und Szenen, Kulissenbau, weiterhin die strenge Hierarchie im Team und Personenkult-Bildung wie auch die früher unbekannte Sterilität des Studios. |
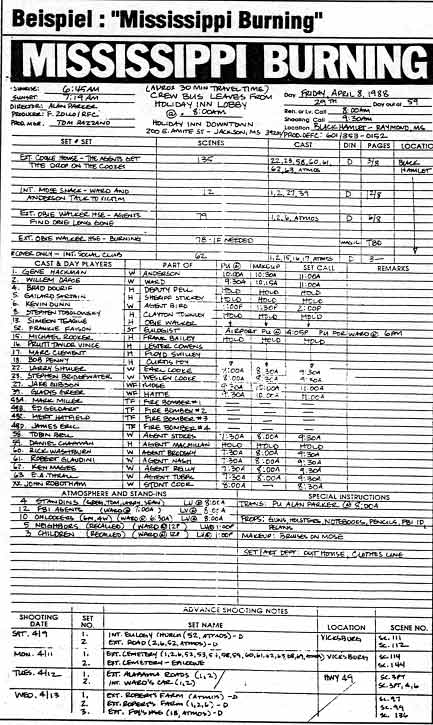 |
| Abb: Produktionsplan für einen Drehtag von "Mississippi
Burning" mit präziser zeitlicher Planung der Crew, der Schauspieler, der
Hintergründe und Statistiken und der zu verwendenden Gegenstände, wie z.
B. Waffen und FBI-Ausweise. |
Die gesteigerte Fiktionalität des Films wurde durch
neue filmtechnische Verfahren, die ohnehin reichlich aus anderen Bereichen
schöpften (z. B. die Filmmontage aus der photographischen Collagetechniken
usw.), noch intensiviert. Die unlogischen, unkausalen Konstrukte orientierten
sich anfangs an den wenigen verwertbaren Konventionen der traditionellen
Medien wie Bühnenkünste und Literatur, aber auch Musik und Malerei und
natürlich der frühen Performance-Kunst (z. B. Dada). Bald erstellten sie,
im Laufe der oft multimedial angesetzten künstlerischen Bewegungen, eigene
Muster wie Rückprojektion, Objektivmasken, Stopptrick, Rücwärtslauf, verschiedene
Simultanitätsverfahren und Schnitttechniken wie z. B. Zeitraffer. Die
Kamera war aber nicht nur das am besten geeignete Medium, um Bewegung
festzuhalten, sie begann sich schon früh auch ‚selber' zu bewegen. Bereits
um 1900 wurde sie mit der Eisenbahn kombiniert; Oskar Messter gelang es
1915 eine halbautomatische Fliegerfilmkamera zu bauen; Guido Seeber koppelte
im Ersten Weltkrieg eine Kamera mit dem Maschinengewehr des Flugzeugs
und steigerte paradigmatischerweise die Treffgenauigkeit der Schützen.
(Vgl. zum Thema Verkehr und Kino: Paul Virilio: Krieg und Kino. Logistik
der Wahrnehmung. München u. Wien 1986, S. 19-36 bzw. Ders.: Rasender Stillstand.
Essay. München u. Wien 1992, S. 52-54.) |
Die Annäherung der Kamera-Aufnahmen and die menschliche
Seh- und später Hörweise ist vielleicht die anschaulichste Zuspitzung
der Verschmelzungsphänomens Mensch-Maschine. Das Wahrnehmungs- und Produktionsmuster
wurde - wie schon bei der Laterna Magica - ‚spiegelweise' umgekehrt. Das
natürliche Auge wurde durch die maschinelle Variante dessen ersetzt, was
wiederum zu einer intensiveren Reflexion über die Entmenschlichung im
Techno-Paradigma führte. Der Körper emanzipierte sich allmählich zu den
Bedingungen seiner physischen, technisierten Umgebung: |
Ein gewisser Erfolg der Immersionstechnologie
wird beim heutigen Entwicklungsstand jedoch höchstens in realitätsferneren
Bereichen der Freizeitindustrie verbucht. Offenbar reicht für den Durchnittsbenutzer
zur Zeit der bimediale Hightech noch völlig aus. Die dreidimensionale
Tontechnik ist in letzter Zeit nicht nur in den Kinos, sondern generell
dem westlichen Jedermann gut Heimkino und Surround-Systeme koppeln sich
aber wiederum am stärksten mit der entertainerischen Film- und Computerspielindustrie.
Multisensorische Sinneserfahrung mit echter Rückkopplung wäre zur Zeit
vielleicht im Schnittbereicht vom interaktiven Fernsehen und Computernetzen
(samt VR) als zukünftiger multimedialer Kommunikationsplattform erst anzuvisieren.
Und doch gewinnt - als besonderer, isolierter Ort - das Kino durch seine
soziale Räumlichkeit immer wieder den Kampf gegen die Inflation der Reize.
Als Alternative zum Wohnzimmer-gebundenen Multimedia Entertainment bietet
er dem psychisch und physisch überforderten Individuum den vielleicht
geselligsten Fluchtpunkt. |