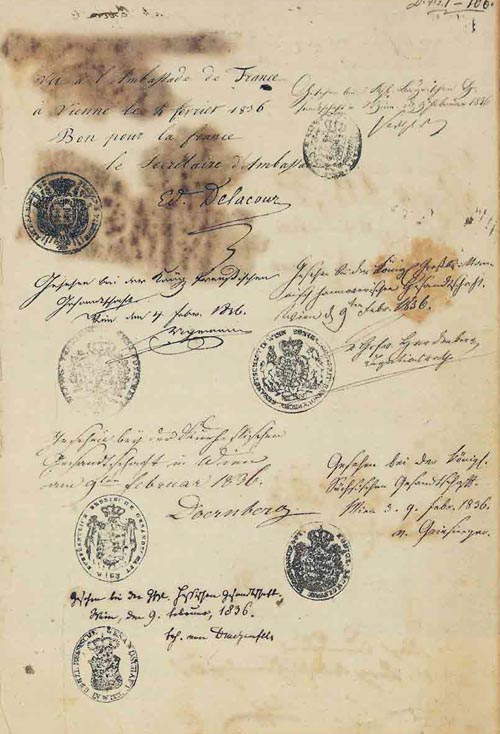Abb: Eine Seite des Reisepassesvon Baron
Camill von Lotzbeck
aus: W.Grieb/ S.Luber (Hg.): Vom Reisen in
der Kutschenzeit. Heide/ Holstein 1990 (Veröffentlichung der Eutiner
Landesbibliothek, Bd.1, Kat.-Nr.32)
Die Passgesetze im europäischen Raum des 19. Jahrhunderts
- besonders noch im damaligen deutschen Kleinstaatengebiet - trugen zu
einer Vergrößerung der 'scheinbaren' Entfernung, also im psychologischen
Sinne bei. Das Reisen wie auch teilweise die damals noch damit eng verbundene
Nachrichtenbeforderung wurden durch die politischen Verhältnisse
stark beeinflusst. Im Bereich der individuellen Grenzübergangsgenehmigungen
und des Visierens gab es in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
in Österreich (wie auch im übrigen deutschsprachigen Raum) streng
reglementierende Migrationsgesetze. Die Aus- und Einreisemöglichkeiten
wurden durch Ausstellung von Reisepässen und Visen nach Alters- und
Standeskriterien zentral kontrolliert und folgten oft den sich damals
schnell ändernden politischen Richtlinien des jeweiligen Gebiets.
Nicht jeder Bürger und nicht jedes - im weitesten Sinne - Geschlecht
durfte die Grenze überqueren.
Genaueres ist der Beschreibung des Reisepasses im Ausstellungskatalog
zu entnehmen:
Österreichischer Reisepaß von 1836
Der Reisepaß im Format 22 x 33 cm enthält
15 Blätter und ist in Leder gebunden. Der Name des Besitzers, Baron
Camill von Lotzbeck, ist auf dem Vorderdeckel aufgeprägt. Das erste
Blatt trägt die Personalien und die Eintragungen der ausstellenden
Behörde, Blatt 2-15 sind mit Sichtvermerken der deutschen Staaten,
sowie von Böhmen, Frankreich, Belgien, den Niederlanden, England,
Spanien, Italien und Sizilien aus den Jahren 1836 bis 1844 versehen. Der
Reisepaß wurde 1836 durch den österreichischen Gesandten Karl
Friedrich Freiherr von Tettenborn ausgestellt:
»Reisepass No. 5. Gültig auf ... [nicht lesbar]. Friedrich
Carl Freyherr von Tettenborn Sr. Königliche Hoheit des Grossherzogs
von Baden General-Lieutenant und Generaladjutant, Commandeur des Grossherzoglichen
Militär-Ordens... Ausserordentlicher Gesandter und bevollmächtigter
Minister bey Seiner Kaiserl. Königl. Apostolischen Majestät
Ersuche hierdurch alle Militär- und Civil-Behörden dem Vorzeiger
dieses, Baron Camill von Lotzbeck, Großherzoglichen Kammerjunker,
welcher durch die teutschen Bundesstaaten nach Paris reiset, frey und
ungehindert reisen und zurückreisen, ihm auch nöthigenfalls
allen Schutz und Beystand angedeihen zu lassen. Gegeben Wien den 5 Februar
Eintausend Achthundert Dreißig Sechs. [Unterschriften:] Camill Lotzbeck.
Tettenborn.«
Die Paßgesetze des 19. Jahrhunderts erschwerten – ebenso wie
die deutsche Kleinstaaterei – das Reisen ungemein und machten es
in vielen Fällen gar unmöglich. So schreibt die »Allgemeine
Encyklopädie der Wissenschaften und Künste« von Ersch
und Gruber 1840: »Am strengsten sind in allen diesen Beziehungen
die österreichischen Vorschriften, ob sie gleich den Satz anerkennen,
daß es Jedermann freistehe, seiner Verrichtung wegen nach fremden
Landen zu reisen. Es muß nach jenen Vorschriften Jeder mit einem
Reisepasse versehen sein und sich damit – bei Handwerksgehilfen
reicht dazu eine Kundschaft nicht aus – bei dem Grenzzoll- und Polizeiamte
legitimieren. Der Versuch des Austritts ohne diese Legitimation hat Arretierung
und Ablieferung and die Behörde zur Folge. Es darf auch der Reisepaß
nicht Jedem auf sein bloßes Begehren ertheilt, es muß ein
wichtiger Grund dazu angegeben und es dürfen nicht etwa Gesundheit
und Vermögensangelegenheiten zum bloßen Vorwande für Luxusreisen
gemacht werden.« Auch dem Adel »soll die Reiseerlaubniß
nicht vor dem 28. Jahre ertheilt« werden; unter Umständen mußte
das Gesuch bis zur höchsten Landes- und Polizeibehörde gehen.
Am Aufenthaltsort mußte der Paß dann »visiert«,
d.h. mit einem Visum versehen werden. »Der Beamte hat dabei den
Paß nach seiner äußeren Form sowol, namentlich in Beziehung
auf eine etwaige Verfälschung, als rücksichtlich der Frage,
ob er auf den Fremden genau paßt, und sonst rücksichtlich seiner
Richtigkeit zu prüfen, die Erlaubniß zur Weiterreise, wenn
sich kein Anstand dagegen findet, in der Regel auch die nächste Stadt,
wo der Reisende wieder ein Visum beizubringen hat, dabei zu bemerken.«
Diese Visierung konnte zur zeitraubenden Erfahrung bürokratischer
Sturheit werden, (wenn auch Adelspersonen wie der Baron von Lotzbeck davon
wohl weniger betroffen waren): »Übel ist es freilich, daß
oft Reisende dadurch ungebührlich aufgehalten werden, daß die
Visierung nicht sofort, oft sogar grade erst in der Zeit erfolgt, wenn
die Post nach einem bestimmten Orte, z.B. in einen bestimmten Staat, abgegangen
ist, in den man ohne Visum der Gesandtschaft, die erst nach Abgang der
Post visiert, nicht gelangen kann. Indessen sind diese Übelstände,
Gott Lob! in Teutschland nur selten.«
(Ersch/Gruber: Encyklpädie, III. Sec. 13. Teil, S.
|