| Theorieinput: Maximen für Projektgruppen/Teamarbeit in Anlehnung an die Vorstellungen der TZI | |
| Handreichung für Teilnehmer |
|
|
| Ziel | |
| Die auf Ruth Cohn zurückgehende Schule der "Themenzentrierten Interaktion" hat versucht, das Zusammenwirken der verschiedenen Kräfte in Arbeitsgruppen | |
| zu modellieren. |
| Das TZI-Dreieck und die "Gruppengesprächsregeln" sollen die drei Perspektiven deutlich machen, unter denen Teamarbeit zu betrachten ist. Die Kunst besteht darin, zwischen diesen Perspektiven und den sich aus ihnen ergebenden Interventionen ein Gleichgewicht herzustellen. Dies setzt Programmwechsel, d. h. die Betonung mal des einen, mal des zweiten und mal des dritten Aspekts voraus. In Gruppen werden nicht immer alle Teilnehmer mit dem gleichen Programm arbeiten. Vielleicht bilden sich auch Spezialisten für einzelne Perspektiven, z. b. zur Pflege des Gruppenklimas heraus. Generell ist es hilfreich, wenn das Team in der Lage ist, zu erkennen und zu thematisieren, mit welchem Programm es gerade arbeiten muss. Eine strikte Festlegung einzelner Personen auf eine bestimmte Perspektive ist auf Dauer selten vorteilhaft. | |
| Das TZI-Dreieck | |
| Auf die Aufgabe das Blitzlicht orientieren! | |
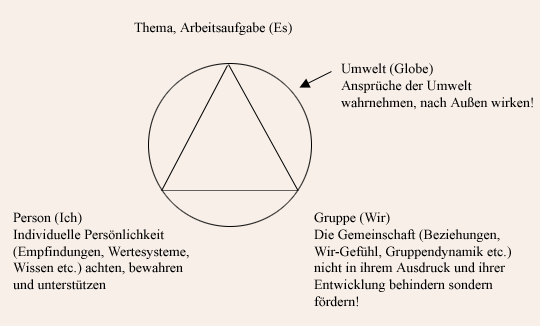 |
|
| Neben den Hauptpostulaten der TZI (Chairmansship und Störungsvorrang) werden in der Literatur üblicherweise noch zehn interaktionelle Hilfsregeln formuliert, die als sogenannte 'TZI-Regeln' weite Verbreitung gefunden haben. Für sie gibt es zahlreiche verschiedene Formulierungen und mittlerweile auch zahlreiche Ergänzungen. Nachfolgend sind 14 Maximen zusammengestellt, die den Mitgliedern von Gruppen eine Orientierungshilfe geben können. Jede straffe Leitung zeichnet sich dadurch aus, dass sie die Wahlmöglichkeiten zwischen den Maximen einschränkt. Außerdem wird in Teams die Kooperationsaufgabe grundsätzlich schwerer gewichtet als die 'Person' und die 'Gruppe'. Sie, und nicht die Persönlichkeitsentwicklung oder die Gruppendynamik führen zur Entstehung des sozialen Systems. Die hier aufgeführten Maximen gelten also immer dann, wenn Gruppen versuchen, die typisch gruppendynamische Sichtweise zu verlassen und kooperative Gesichtspunkte (Teamperspektiven) aufzunehmen - oder wenn Teams ihre Selbstbeschreibung um gruppendynamische Gesichtspunkte erweitern wollen. Es sind Regeln, die der Integation verschiedener Programme und Modelle dienen. | |
| 1) | Seien Sie Ihr eigener 'Vorsitzender' | |
Diese Regel soll zwei Dinge bewusst machen: Sie haben
die freie Entscheidung und die Verantwortung, was Sie aus dieser Zeit
machen. |
||
| 2) | Störungen haben Vorrang | |
| Beachten Sie Ihre Empfindungen und Gefühle, die Ihnen
anzeigen, dass Sie nicht teilnehmen können (z. B. wegen Schmerzen,
ärger oder Freude), dass hier etwas nicht stimmt, anders verläuft,
als Sie es sich vorgestellt haben. Unterbrechen Sie das Gespräch, wenn
Sie nicht wirklich teilnehmen können und Ihnen Ihre Störung wichtiger
erscheint, als der derzeitige Verlauf der Gruppe. Ein 'Abwesender' verliert nicht nur seine Möglichkeiten in der Gruppe, sondern bedeutet auch ein Verlust für die ganze Gruppe. |
||
| 3) | Beachten Sie Ihre Körpersignale | |
| Um besser herauszubekommen, was Sie im Augenblick empfinden, fühlen und wollen, achten Sie auf Ihre Körpersignale. Diese können oft mehr über Ihr Befinden und Bedürfnis sagen als Ihr Kopf. Versuchen Sie, sich Ihres inneren Zustands bewusst zu werden. Konzentrieren Sie sich nicht nur auf die Gruppenleistung, sondern auch auf sich selbst, auf Ihr inneres Erleben. | ||
| 4) | Wenn Sie wollen, bitten Sie um ein Blitzlicht | |
| Wenn die Situation in der Gruppe für Sie nicht mehr transparent ist, dann äußern Sie zunächst Ihre Störung und bitten dann die anderen Gruppenmitglieder, in Form eines Blitzlichts auch kurz ihre Gefühle im Moment zu schildern. | ||
| 5) | Seien Sie selektiv-authentisch | |
| Machen Sie sich bewusst, was Sie wahrnehmen, denken und
fühlen und wählen Sie aus, was Sie sagen und tun wollen. Seien Sie authentisch und selektiv. Nicht alles, was möglich ist, muss gesagt oder getan werden. Aber was Sie sagen, soll authentisch sein. |
||
| 6) | Sprich per 'Ich' statt per 'Man' oder 'Wir' | |
| Sprechen Sie über Ihre persönliche Meinung möglichst
nicht per 'man' oder 'wir'. übernehmen Sie
die Verantwortung für Ihre Aussagen. Zeigen Sie sich als Person und
sprechen Sie per 'Ich'. Mit Verallgemeinerungen wie 'man, wir, alle' erwecken Sie den Anschein, Sie seien autorisiert für andere mitzusprechen, von denen Sie in der Regel nicht wissen, ob diese das wünschen. Typisch wäre dafür z. B. die folgende Redewendung: "Wir sind uns doch alle einig darin, das.......!". |
||
| 7) | Sprechen Sie direkt |
|
| Wenn Sie jemandem in der Gruppe etwas mitteilen wollen, sprechen Sie ihn besser direkt an und zeigen Sie ihm (durch Blick-Kontakt), dass Sie ihn meinen. Sprechen Sie nicht über einen Dritten zu einem anderen und sprechen Sie nicht zur Gruppe, wenn Sie einen bestimmten Teilnehmer in der Gruppe meinen. - Setzen Sie sich direkt und persönlich mit allen Mitgliedern der Gruppe auseinander. | ||
| 8) | Unterscheiden Sie, ob Sie etwas sollen oder wollen | |
| Versuchen Sie für sich herauszufinden, was Sie tatsächlich
meinen, wenn Sie z. B. sagen: "Ich weiß nicht was ich jetzt
tun soll!". Warten Sie in diesem Fall auf die Anweisung einer Autorität,
die Ihnen sagt was Sie sollen und was nicht - oder wollen Sie damit ausdrücken,
dass Sie im Moment nicht wissen, was Ihre Wünsche sind? Als Mensch habe ich eine Entscheidungsfreiheit: Wenn ich vor etwas Angst habe, dann kann ich mich dazu entscheiden, es nicht zu tun oder aber es mit Angst zu tun. Wenn ich mir etwas ganz stark wünsche, kann ich es mir, wenn möglich, erfüllen oder aber ich kann auf die Erfüllung des Wunsches verzichten. Unterscheiden Sie für sich: - ich muss - ich soll - ich darf - ich kann - ich will; ebenso die Verneinung: ich kann nicht, usw.. |
||
| 9) | Experimentieren Sie mit Ihrem Verhalten | |
| Tun Sie, was Sie eigentlich wollen? Welche Rücksichten,
auf wen oder was halten Sie davon ab? Was passiert, wenn Sie alternative
Verhaltensweisen ausprobieren? Testen Sie, ob Ihre Erwartungen, Ängste,
Hoffnungen bei ungewohntem Verhalten tatsächlich eintreten. Diese Regel gilt in Trainings uneingeschränkt, ansonsten wird man sich die Situation aussuchen, in denen Experimente sinnvoll sind. |
||
| 10) | Eigene Meinungen statt Fragen | |
| Wenn Sie eine Frage stellen, sagen Sie, warum Sie diese
stellen bzw. was sie Ihnen bedeutet. Eröffnen Sie dem Anderen Ihre
Vermutungen und Beweggründe. Die meisten Fragen sind keine 'echten' Fragen. Häufig dienen sie dazu, den eigenen Standpunkt bestätigen zu lassen. Fragen sind oft auch eine Methode, sich und seine Meinung nicht zu zeigen. Fragen können inquisitorisch wirken und den Anderen in die Enge treiben. Äußern Sie stattdessen Ihre Meinung, geben Sie dem Anderen die Möglichkeit, Ihnen zu widersprechen oder sich Ihrer Meinung anzuschließen. |
||
| 11) | Geben Sie Rückmeldung (Feedback) über Ihre Wahrnehmungen und Meinungen und vermeiden Sie Interpretationen | |
| Wenn Sie Wahrnehmungen über andere mitteilen, sagen Sie auch, was diese für Sie bedeuten. Es kann beim Anderen sonst sehr schnell der Eindruck von Be- und Verurteilen entstehen. Interpretationen haben oft den Charakter von Festlegungen ("Du bist so, und zwar für alle Ewigkeit"), was ungute Gefühle und Widerstand auslösen kann. Sprechen Sie von Ihren Eindrücken und Gefühlen, die durch den Anderen bei Ihnen ausgelöst wurden. Versuchen Sie das Verhalten des Anderen so genau und korrekt wie möglich zu beschreiben, damit er/sie verstehen kann, was an seinem/ihrem Verhalten Ihre Reaktionen ausgelöst hat. Sie brauchen keine objektiven Beweise, auf Ihre subjektiven Eindrücke und Gefühle kommt es an. | ||
| 12) | Hören Sie ruhig zu, wenn Sie Rückmeldung (Feedback) erhalten | |
| Versuchen Sie nicht gleich, sich zu verteidigen oder die Sache 'klarzustellen', wenn Sie Feedback erhalten. Denken Sie daran, dass Ihnen subjektive Gefühle des Anderen und keine objektiven Tatsachen mitgeteilt werden. Freuen Sie sich, dass Ihr Gesprächspartner Ihnen seine Wahrnehmungen von Ihnen sagt. Versuchen Sie ruhig zuzuhören und überlegen Sie, ob Sie verstanden haben, was er meint. Prüfen Sie, was Sie lernen können aus der Rückmeldung (nicht, warum Sie nichts lernen müssen). | ||
| 13) | Seitengespräche haben Vorrang | |
| Seitengespräche stören das Gruppengespräch,
da die Aufmerksamkeit aus der Gruppensituation abgezogen wird und Phantasien
über die möglichen Inhalte des Seitengesprächs aktiviert
werden ("Sprechen die über mich?"). Seitengespräche sind wichtig, da sie oft eine unbefriedigende Situation in der Gruppe signalisieren. Manchmal dienen Seitengespräche einer spontanen Zuwendungsbefriedigung, da es schwieriger sein kann, Zuwendungswünsche innerhalb und durch die Gruppe, als im Zweierkontakt zu befriedigen. Bringen Sie Ihre Seitengespräche in die Gruppe, damit alle teilnehmen und sich Ihnen zuwenden können oder versuchen Sie Ihren Wunsch nach Zweierkontakt bis zur Pause aufzuheben. |
||
| 14) | Nur einer zur gleichen Zeit | |
| Wenn mehrere Gruppenmitglieder zur gleichen Zeit sprechen, ist das oft Ausdruck von starkem Engagement, manchmal auch (Leidens)Druck der Teilnehmerinnen. Akustisch allerdings ein Dilemma, deshalb der Vorschlag: Bitte einigen Sie sich - bei Gleichzeitigkeit - wer beginnt. | ||
|
|