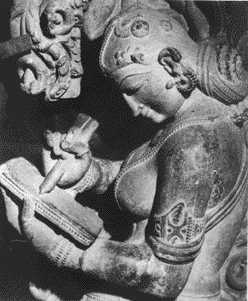
| Einführung - Kulturgeschichte als Kommunikations- und Mediengeschichte |
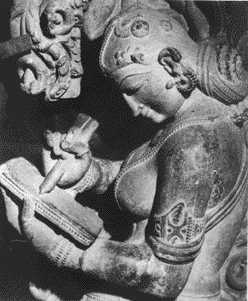 |
| Kommunikationsgeschichte 3D betrachtet die Kulturgeschichte
aus informationstheoretischer Sicht als Evolution von Information, Informationsverarbeitung,
Kommunikativen Netzen und Medien. Aus den Analysen sollen sich Trends für
die Zukunft der Informationsgesellschaft und Maximen für die Kultur-
und Medienpolitik ableiten lassen. Ziel der Studien ist es, die gegenwärtigen Formen kultureller Kommunikation und ihrer Medien als Stufe eines ökologischen Evolutionsprozesses zu verstehen. Neben den drei Grundvorstellungen von Kommunikation als |
| Informationsverarbeitung | |
| Vernetzung | |
| Spiegelung |
| bedarf es hierzu: |
| 1. | eines weiten, ökologischen Kulturkonzepts und evolutionstheoretischer Annahmen |
| 2. | orientieren sich die empirischen Analysen an Prozessmodellen. Dem ökologischen Ansatz entsprechend müssen ganz unterschiedliche Arten von Prozessen zueinander in Beziehung gesetzt werden. |
| Mindestens sind Grundannahmen über die Geschichte als Prozess, etwa als |
| Chronologie | |
| Veränderung | |
| Entwicklung |
| sowie über kulturelle
Prozesse zu klären. Je nach den zugrundegelegten Annahmen ergeben sich unterschiedliche Perspektiven auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Die Möglichkeiten für eine Vorausschau und das Mangement von kultur- und medienpolitischen Prozessen verändern sich. |
| Grundannahmen kulturgeschichtlicher Trendforschung |
| Kulturen aus kommunikationstheoretischer Sicht
|
Kulturveränderung erscheint aus dieser ökologischen
und kommunikationstheoretischen Sicht als Veränderung
|
| Vorzüge des informationstheoretischen Ansatzes: |
| Allgemeingültigkeit |
| Dieser Ansatz erlaubt es, die Dynamik kultureller Prozesse als Gegen- und Miteinander verschiedener Formen sozialer, psychischer, technischer und anderer Informationsverarbeitung zu verstehen. Allgemein kann man zwischen Wahrnehmungs-, Verarbeitungs-, Reflexions-/Steuerungs- und Darstellungsprozessen und den entsprechenden verschiedenen Speichermedien unterscheiden. Es ist jeweils empirisch zu entscheiden, welche technischen, psychischen, biogenen, sozialen u. a. Prozesse von sozialen Gemeinschaften als Wahrnehmung, Kommunikation, Informationsspeicherung usf. verstanden werden und wie man sie normiert, technisiert usf. |
| Interdisziplinäre Integrationskraft |
| Das Modell informationsverarbeitender Systeme ist komplex genug, um bislang getrennt voneinander operierende Forschungsansätze zueinander in Beziehung zu setzen. Kulturanthropologische Ansätze beispielsweise haben sich bislang vorzugsweise mit der Evolution der individuellen Wahrnehmungsprozesse und Sinnesorgane beschäftigt. Mit den Programmen sozialer Informationsverarbeitung beschäftigen sich Studien zum Mentalitätswandel. Unter dem Stichwort 'kulturelles Gedächtnis' werden die Speicher thematisiert. Die Technikgeschichte liefert Beiträge zur Technisierung der verschiedenen Prozessoren und mit den Ausdrucks- und Darstellungsformen haben sich Literatur- und Sprachhistoriker befasst. Die Techniksoziologie thematisiert häufig Steuerungs- und Rückkopplungsphänomene. Ohne den Gesamtkreislauf der Informationsverarbeitung im Blick zu haben, lassen sie jedoch die einzelnen Phasen und Elemente nicht verstehen, weil sie interaktiv, rekursiv, prospektiv usf. miteinander verknüpft sind. |
| Klärung der Katalysatoren von Veränderungsprozessen |
| Innovationen können mal über die Veränderung der Wahrnehmung, mal über die Technisierung von Speichermedien, mal über neue Vernetzungsformen, mal über alternative Verarbeitungsprogramme, mal durch neue Kontrollmöglichkeiten usf. in Gang gesetzt werden. Bei revolutionären Veränderungen, wie sie z. B. in der frühen Neuzeit vorliegen, treffen verschiedene Katalysatoren relativ zeitgleich zusammen. Es kommt, wie ich am Beispiel des typographischen Systems der Buchkultur gezeigt habe, zu einer Umgestaltung aller Elemente des informationsverarbeitenden Systems. |
| Innovationsspirale |
| Differenzierung der Entwicklungslinien |
| Weiterhin zwingt das Modell zu einer Klärung des Bezugssystems.
Beispielsweise muss zwischen psychischer und sozialer Informationsverarbeitung
unterschieden werden. Soziale Informationsverarbeitung kann in Dyaden, Gruppen,
Institutionen, Gesellschaften und deren Sub- und Supersystemen ablaufen.
Es gibt nur ganz wenige elementare Strukturen und Programme, die in allen
diesen Typen gleichermaßen gelten. Ansonsten ist zu differenzieren.
Aus informationstheoretischer Sicht lautet beispielsweise die grundlegende
Frage, die sich die Industriegesellschaften seit der frühen Neuzeit
stellen mussten: Wie ist Parallelverarbeitung über die Umwelt
zwischen einem Autoren und seinen vielen (ihm unbekannten) Lesern nur mit
Hilfe von ausgedruckten Büchern, ohne die Möglichkeit schneller
Rückkopplung und Interaktion zu organisieren. Es ging also um einen neuen Typus gesellschaftlicher Informationsverarbeitung und nicht in erster Linie um eine Verbesserung der individuellen psychischen Informationsverarbeitung und der Organisationskommunikation, wie sie bei der Einführung der Schrift in der Antike angestrebt wurde. |
| Prognostische Kraft |
| Kooperative Informationsverarbeitung folgt, wie andere
Formen der Arbeitsteilung auch, gewissen Regelmäßigkeiten. Insbesondere
muss ein Gleichgewicht zwischen Differenzierung und Integration erreicht
werden. Außerdem gibt es Probleme der Informationsverarbeitung, die
in der Industriegesellschaft gut, und solche, die weniger gut gelöst
sind. Es ist zu erwarten, dass die zukünftige Informationsgesellschaft
Antworten auf die offenen Fragen suchen wird. sh. auch: Entwicklungslinien der Informationsgesellschaft und Aufgaben einer zeitgemäßen Kommunikationsgesellschaft |